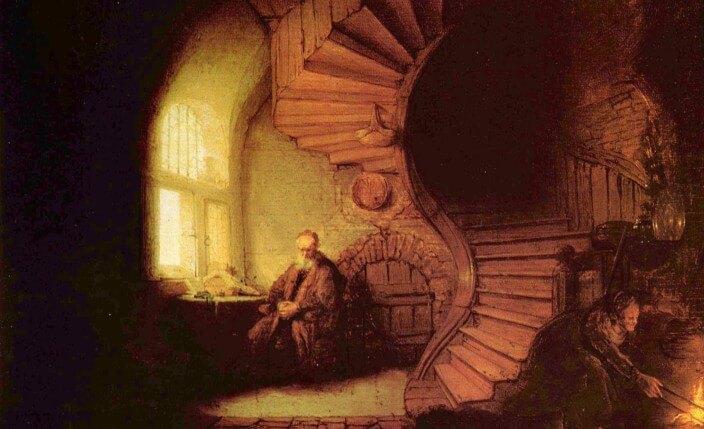
Abstract: LehrerInnen und auch Studierende sind ob mancher theoretischer Diskussionen in der Geschichtsdidaktik nicht selten verwundert bis verärgert. Die Frage nach der Relevanz einer oftmals abgehoben erscheinenden Wissenschaft ist tatsächlich nicht immer unberechtigt. Selbstverständlich besitzt zwar der Diskurs über Theorien, die Grundlagenforschung, ihre Berechtigung und ihre Notwendigkeit. Allerdings hapert es eben an der praktischen Umsetzung. Es stünde daher der Geschichtsdidaktik gut an, den “Elfenbeinturm”, in dem sie sich gerne selbst feiert, gelegentlich zu verlassen.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-1931.
Languages: Deutsch
LehrerInnen und auch Studierende sind ob mancher theoretischer Diskussionen in der Geschichtsdidaktik nicht selten verwundert bis verärgert. Die Frage nach der Relevanz einer oftmals abgehoben erscheinenden Wissenschaft ist tatsächlich nicht immer unberechtigt. Selbstverständlich besitzt zwar der Diskurs über Theorien, die Grundlagenforschung, ihre Berechtigung und ihre Notwendigkeit. Allerdings hapert es eben an der praktischen Umsetzung. Es stünde daher der Geschichtsdidaktik gut an, den “Elfenbeinturm”, in dem sie sich gerne selbst feiert, gelegentlich zu verlassen.
“Mit Worten läßt sich trefflich streiten”
Michael Sauer hat an dieser Stelle erst kürzlich das “E=mc2” der Geschichtsdidaktik, wie Martin Lücke die Formel “Sinnbildung über Zeiterfahrung” bezeichnet hat, kritisch hinterfragt. Die Reaktionen darauf blieben freilich nicht aus, ein Rekord an Kommentaren war zu verzeichnen. Im Namen des wissenschaftlichen Fortschritts ist dies freilich zu begrüßen, dennoch ist die große Anzahl an Stellungnahmen auch symptomatisch für eine Didaktik, die den Weg in die Praxis offenbar nur schwer bzw. oftmals gar nicht findet. Wie kann es ansonsten sein, dass ein Beitrag über Methodik, wie er von Christoph Kühberger geliefert wurde, kaum zu Stellungnahmen angeregt hat. Immerhin weist aber auch Monika Fenn mit ihrem Beitrag zum conceptual change den Weg in eine pragmatische Geschichtsdidaktik. Wie ein solcher Weg nun beschritten werden soll, ist aber noch ausführlich zu diskutieren.
Sichern, abseilen, Wege finden …
Der Redaktionssitz von Public History Weekly befindet sich in der Schweiz, und so ist die Metapher des alpinen Abstiegs durchaus passend: GeschichtsdidaktikerInnen müssen sich sichern (theoretisch fundieren), müssen sich abseilen und Wege in die Niederungen finden (die Theorie durch die Entwicklung einer Methodik, durch das Ausprobieren adäquater Methoden sowie schließlich durch den Lackmustest in der Praxis verifizieren oder letztlich auch modifizieren). Alle theoretischen Diskussionen der letzten Jahre zielen darauf ab, das traditionelle Instruktionsparadigma durch die Ermöglichung von “kooperativen Deutungsprozessen” (Jürgen Habermas), durch das interpretative Paradigma, das wechselseitige Verständigung vorsieht, abzulösen. Dabei ist darauf zu achten, historisches Lernen vor allem in die Lebenswelten der Lernenden einzubetten und es als bedeutungsvoll für die eigene Lebenswelt erkennbar zu machen (konzeptuelles Lernen, Prozessorientierung, Adressaten- und Lebensweltorientierung) sowie den aktiv-handelnden Umgang mit Lerngegenständen zu ermöglichen (Handlungsorientierung).
Geschichtsdidaktische Lernverfahren
Zugegeben: Diese Überlegungen klingen genauso kompliziert wie die Diskussionen über Geschichtsbewusstsein, Sinnbildung über Zeiterfahrung oder über die diversen Kompetenzmodelle, die in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt haben. Aber sie gehören eben auch zur theoretischen Diskussion und sind daher durchaus notwendig. Für die Praxis lassen sie sich verständlich machen, wenn wir sie zum Beispiel in die geschichtsdidaktische Trias der darbietenden, erarbeitenden und forschend-entdeckenden Lernverfahren einbetten: Die Geschichtsdidaktik muss Methoden verwenden und Lernarrangements entwickeln, die einerseits die Vermittlung von Informationen ermöglichen und andererseits die Individuen miteinbinden, indem deren unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigt, Multiperspektivität gefördert und deren Kompetenzen geschult werden. Alle drei Lernverfahren sind ineinander verschränkt zu betrachten: Sowohl fertige “Unterrichtsprodukte” als auch die Handlung als didaktischer Eigenwert müssen gleichberechtigt nebeneinander, zugleich aber je nach Lehr- und Lernzielen auch in eine Hierarchie gestellt werden. Als zentral gilt dabei folgende Maxime: Alle entwickelten Methoden und Lernarrangements sind nicht nur in einen theoretischen Kontext einzubinden, sondern zugleich – durch die Entwicklung von Unterrichtsbeispielen und im Idealfall durch ihre Erprobung und Evaluierung – in die Praxis zu transferieren.
Die Praxis als Zentrum der Geschichtsdidaktik?
Wenn hier die Praxis als Zentrum der Geschichtsdidaktik bezeichnet wird, so ist freilich keineswegs ihre Reduzierung auf eine schlichte Anwendungslehre gemeint, die vor allem durch Praxis, d.h. durch und im Unterricht entwickelt wird. Vielmehr wird darunter die praktische Erprobung theoretisch-methodischer Überlegungen verstanden, die auch empirisch begleitet werden sollte. Schließlich muss erneut der Aufstieg in die Höhen der Theorie gewagt werden, der Weg in den Elfenbeinturm, der dann aber umso mühsamer ausfällt, zumal die “Mühen der Ebene”, die Erkenntnisse, die in der “harten” schulischen Realität erworben wurden, in die Theorie einzuarbeiten sind. Dabei besteht zwar die Gefahr, dass manche theoretischen Konstrukte relativiert werden müssen. Aber wie heißt es in dem Song “Scheitern ist schön” von ‘Fiasco Électrique’? “Auch der Bauchfleck will gelernt sein / Wenn das Misslingen dich zerbricht / Denn schöner scheitert zumeist jener / Der es bedingungslos verficht”. Aus dem schönen und bedingungslosen Scheitern kann ja letztlich auch Produktives entstehen. Vielleicht muss die Geschichtsdidaktik dann auch nicht mehr ständig, wie Michele Barricelli in einem früheren Beitrag in Public History Weekly beklagt hat, in Verteidigungshaltung gegenüber den LehrerInnen und Studierenden gehen.
_____________________
Literaturhinweise
- Günther-Arndt, Hilke (Hrsg.): Geschichtsmethodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II, 4. Auflage, Berlin 2012.
- Völkel, Bärbel: Handlungsorientierung im Geschichtsunterricht, 2. Auflage, Schwalbach/Ts. 2008 (Methoden historischen Lernens).
- Wenzel, Birgit: Kreative und innovative Methoden. Geschichtsunterricht einmal anders, 2. Auflage, Schwalbach/Ts. 2011 (Methoden historischen Lernens).
Webressourcen
- Song ‘Scheitern ist schön’ (Album ‘Nur Passagier’) der Band Fiasco Électrique: http://fiascoelectrique.bandcamp.com/track/scheitern-ist-sch-n
- Interdisziplinäres Projekt mit dem Schwerpunkt Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung: http://www.didactics.eu/index.php?id=988
____________________
Abbildungsnachweis
© Zenodot Verlagsgesellschaft mbH / Wikimedia Commons. Lizenzfreie Darstellung des Gemäldes ‘Meditierender Philosoph’, vermutlich Rembrandt (1632). Ausgestellt im Musée de Louvre, Richelieu, 2. Stock, Saal 31.
Empfohlene Zitierweise
Hellmuth, Thomas: Geschichtsdidaktik im Schatten des Elfenbeinturms. In: Public History Weekly 2 (2014) 16, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-1931.
Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact the editor-in-chief (see here). All articles are reliably referenced via a DOI, which includes all comments that are considered an integral part of the publication.
The assessments in this article reflect only the perspective of the author. PHW considers itself as a pluralistic debate journal, contributions to discussions are very welcome. Please note our commentary guidelines (https://public-history-weekly.degruyter.com/contribute/).
Categories: 2 (2014) 16
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-1931
Tags: History Didactics (Geschichtsdidaktik), Theory (Theorie)
„Ich habe vor dem Ausdruck Elfenbeinturm gar keine Angst“ [1]
Wieder einmal ein Beitrag, der erstaunt. Liest er sich doch wie aus der Zeit gefallen. Die vom Autor Thomas Hellmuth beklagte “Praxisferne” der Geschichtsdidaktik: Eine der “großen” Erzählungen der Disziplin, die sich immer wieder gerne erzählt wird; der “Elfenbeinturm” eine gern herangezogene Metapher, die immer wieder gerne Verwendung findet und sicher auch bei zahlreichen Lehrenden, in Schule wie auch Hochschule, Zustimmung finden wird. Auch die aufgeführte Lösung des Problems verwundert. So fordert Hellmuth die “praktische Erprobung theoretisch-methodischer Überlegungen”. Nichts anderes tun die professionellen Lehrerinnen und Lehrer als “reflective practitioners” doch jeden Tag.
Auch erschließt sich mir der Zusammenhang zwischen dem von Thomas Hellmuth konstatierten “Kommentarrekord” angesichts theoretischer Reflexionen und der Praxisferne der Geschichtsdidaktik angesichts konstatierter Sprachlosigkeit nicht. Vielleicht braucht es einfach nur einen gut geschriebenen, kritisch-polemischen und kontrovers angelegten Beitrag, Versuche “das stagnierende Gewässer mit frischem Wind in Bewegung zu bringen”,[2] um zu mehreren Kommentaren anzuregen. Beiträge, die im Graubereich der Zustimmung mäandern, abseitige Inhalte postulieren oder Altbekanntes erneut verkaufen, bleiben unerhört und unerwidert. Zu Recht! Da gibt es doch weitaus Aufregenderes zu tun. Dass bei diesen Versuchen Theorien eine wichtige Funktion zukommt, steht doch wohl außer Frage. Sind es doch eben diese, die zu Unsicherheiten und Irritationen führen und uns unser praktisches Tun überdenken lassen.
Anmerkungen
[1] Keine Angst vor dem Elfenbeinturm. Spiegel-Gespräch mit dem Frankfurter Sozialphilosophen Professor Theodor W. Adorno, in: Der Spiegel v. 5.5.1969, online http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45741579.html (zuletzt am 2.5.2014).
[2] Pandel, Hans-Jürgen / Rüsen, Jörn: Bewegung in der Geschichtsdidaktik? Zum Versuch von Rainer Walz, durch Polemik eine Bahn zu brechen, in: GWU 46 (1995), S. 322-329, hier S. 322.
Dieser Kommentar sei mir als einfacher Leser gestattet.
Drei logische Probleme und (mindestens) ein Metaphernunfall
Was ist nur gegen den Elfenbeinturm zu sagen? Zumal von innen? Dieser altehrwürdige und schöne Inbegriff eines kostbaren Reflexions- und Diskursfreiraums ist leider seit längerem zu einer wissenschaftspolitischen Denunziationsvokabel geworden. Man sollte geistesgeschichtliches Tafelsilber nicht ohne Not verscherbeln.
Der Beitrag von Thomas Hellmuth wirft einige weitere Probleme auf, allerdings andere als offenkundig beabsichtigt, nämlich logische. Dabei ist der manchmal überbordende Anspielungsreichtum selbstredend gar nicht gemeint: Nein, in der Schweiz benötigt man nur extrem selten alpine Gerätschaften, gerade von Basel braucht man Stunden bis zum ersten richtigen Berg. Ich selbst bin bisher gänzlich ohne Halteseil ausgekommen. Die Wahrheit liegt immer jenseits des (Alpen-)-Mythos.
Ein Problem ist erstens der performative Widerspruch, den der Initialbeitrag geradezu beispielhaft vor Augen führt. Die Differenz von Aussageinhalt und den sog. Implikaten der Aussage als Sprechakt.
Im Beitrag (wie überhaupt in allen schon zum Topos geronnenen Einlassungen dieser Richtung) behauptet ein Geschichtsdidaktiker normativ, Geschichtsdidaktik müsse (endlich) “die Praxis” in ihr “Zentrum” rücken. Diese Forderung wird gestützt und befindet sich dabei selbst auf einem hoch abstrakten Argumentationsniveau, denn es wird nicht nur in zeitlicher Distanz über Gegenstandspraxis (hier: Unterricht) nachgedacht (= Theorie), sondern in Sachen der Praxis der Theorie theoretisiert. Es handelt sich also um eine sehr spezifische Meta-, resp. Wissenschaftstheorie. Es wird also ziemlich das Gegenteil dessen getan, was gefordert wird. Die vorliegende spezifische Metatheorie ist zugleich, was nun wirklich nicht sein müsste, ausgesprochen empiriefern. Die empirischen Tatsachen der reflektierten Theorie der Praxis werden nicht berücksichtigt oder nicht gekannt. Denn:
Das zweite logische Problem lässt sich auf den Begriff der Hypostasierung bringen. Indem der Autor durchgehend von “der Geschichtsdidaktik” spricht, behauptet er ein Individuum, das bestenfalls ein Kollektivsingular ist, eigentlich aber nur ein Pappkamerad. Offen gestanden habe ich “die” Geschichtsdidaktik noch nirgendwo getroffen. Deshalb kann ich ihr auch keine Vorwürfe machen. Mit solchen Pauschalisierungen tut man sich und anderen gar keinen Gefallen. Es mag ja KollegInnen geben, die sich in etwas verlieren, was ich ungern, wie schon gesagt, “Elfenbeinturm” nennen würde. Dann sollte man allerdings Ross und Reiter nennen und sich nicht ins Abstrakte davonschleichen. Ich für meinen Teil kenne viele KollegInnen, denen man nicht vorwerfen kann und sollte, sie hätten in ihrer eigenen Praxis aus den Augen verloren, worum es in der Wissenschaft vom Geschichtsbewusstsein gehen sollte: Theorie – Empirie – Pragmatik.[1]
Damit bin ich bei einem dritten Problem dieses Beitrags, nämlich dessen ärgerliches Ende in einer Art von moralischem Zirkelschluss: Die Behauptung Michele Barricelli hätte sich darüber “beklagt” (was er nicht hat), “die Geschichtsdidaktik” müsse sich “ständig” in eine “Verteidigungshaltung” gegenüber LehrerInnen und Studierenden begeben – die ist, gelinde gesagt, etwas unfair, wenn man mit seinem Beitrag eben die ältesten und uninformiertesten Alltagstheorien wieder aufwärmt, die dann auf Expertenseite die dann ach so! bedauerlichen Erklärungsbemühungen ja erst auslösen.
Michele Barricelli hat in diesem Journal in dankenswerter Deutlichkeit über das Unzutreffende des hier wieder kolportierten Vorurteils aufgeklärt (s.o.), ich selber habe über den Unsinn einer Entgegensetzung der Begriffe Theorie und Praxis geschrieben. Markus Bernhardt hat zuletzt in Göttingen (2013) bibliometrische Befunde vorgelegt, die den Behauptungen dieses Beitrags widersprechen.[2] Damit sind nur die neuesten widersprechenden und klärenden Veröffentlichungen genannt, Weiteres ließe sich nennen. Jetzt muss dann auch mal gut sein, meine ich.
Falls nicht, wäre es zumindest gut, performative Widersprüche dadurch zu vermeiden, dass man auch hier bei Public History Weekly das macht, was man einfordert. Keine metatheoretischen Spielereien, sondern konkret praxisbezogene Anregungstexte (wir haben davon schon einige).
Weiterhin wäre es gut, Hypostasierungen zu vermeiden: Bitte konkrete Kritiken an hinreichend konkrete Texte und KollegInnen.
Schließlich: Man sollte nicht das verstärken oder herbeiführen, was man dann beklagt. Es gibt für unsereinen schon so genug zu kritisieren und zu optimieren.
Nicht dass sich die GeschichtsdidaktikerInnen nach dem doppelt falschen Elfenbeinturm-Vorwurf auch noch mit dem zumindest begrifflich richtigen des wissenschaftlichen Narzissmus auseinandersetzen müssen.
Anmerkungen:
[1] Jeismann, Karl-Ernst: Didaktik der Geschichte. Die Wissenschaft von Zustand, Funktion und Veränderung geschichtlicher Vorstellungen im Selbstverständnis der Gegenwart. In: Kosthorst, Erich (Hrsg.): Geschichtswissenschaft. Didaktik – Forschung – Theorie, Göttingen 1977, S. 9-33.
[2] Bernhardt, Markus: Geschichtsdidaktik nach PISA – Bilanzen und Perspektiven. Eine bibliometrische Analyse. In: Sauer, Michael et al. (Hrsg.): Geschichtslernen in biographischer Perspektive. Nachhaltigkeit – Entwicklung – Generationendifferenz. Göttingen 2014 (im Druck).
Umberto Eco hat sich in seiner „Nachschrift zum ‚Namen der Rose’“ überrascht gezeigt, welche ihm gar nicht bewussten Interpretationen sein Roman ermöglicht. „Der Autor müsste das Zeitliche segnen“, schreibt er, „nachdem er geschrieben hat. Damit er die Eigenbewegung des Textes nicht stört.“[1] Da ich damit verständlicherweise noch ein wenig warten möchte, werde ich mich zu den Repliken von Christian Heuer und Marko Demantowsky doch äußern.
Zunächst sei darauf hingewiesen, dass es sich freilich bei der „Abseilmetapher“ um keinen Metaphernunfall handelt: Selbstredend wurde ganz bewusst das abgegriffene Klischee der Schweiz als Alpenland gewählt. Wenn schon, wie ich befürchtete, keiner auf den Inhalt des Beitrages reagieren sollte, dann zumindest auf den lächerlichen Alpenmythos. Und siehe da, tatsächlich tappt der “einfache Leser” Marko Demantowsky in die gestellte „Falle“. Für mich etwas überraschend wurde aber auch prompt auf meine Kritik an „der“ Geschichtsdidaktik reagiert (wobei die Hypostase, wie weiter unten noch angesprochen, durchaus im provokativen Sinn verwendet wurde).
Schöner könnte es nicht sein: Die Repliken von Demantowsky und Christian Heuer machen den Mechanismus, der beim Lesen eines Textes in Gang gesetzt wird und bei Eco Erstaunen hervorgerufen hat, exemplarisch nachvollziehbar – Hans-Georg Gadamer[2] hätte seine Freude gehabt! Kaum wird die Metapher des „Elfenbeiturms“ vernommen, scheint die Konditionierung der beiden wirksam und eine Abwehrhaltung eingenommen: Heuer zitiert keinen Geringeren als Theodor W. Adorno und Demantowsky sieht gar den „altehrwürdige[n] und schöne[n[ Inbegriff eines kostbaren Reflexions- und Diskursfreiraums“ in Gefahr. Und das, obwohl der Text keineswegs den „Elfenbeinturm“ per se in Frage stellt! Ganz im Gegenteil wird ja der Notwendigkeit des Diskurses im „Elfenbeinturm“ (oder wie immer man diesen „altehrwürdigen“ und „kostbaren“ Raum bezeichnen will) deutlich Ausdruck gegeben. Nicht zuletzt damit, indem – wie Demantowsky ganz zu Recht schreibt – „in Sachen der Praxis der Theorie theoretisiert“ wird. Durch diese Metatheorie erweist sich der vermeintliche Widerspruch, den Demantowksy konstatiert, letztlich als gar nicht vorhanden. Ein solcher wäre nur gegeben, wenn tatsächlich eine Dichotomie zwischen Theorie und Praxis angenommen würde.
Ähnlich wie mit dem „Elfenbeinturm“ verhält es sich mit dem Hinweis Heuers, dass die „reflective practitioners“ täglich theoretisch-methodische Überlegungen in der Praxis erproben. In meinem Text wird dies gar nicht bezweifelt, vielmehr scheint diese Feststellung letztlich Ergebnis eines filternden Lesens. Gerade die Versuche von LehrerInnen, die Theorie auf die Praxis zu übertragen, lassen ob der Komplexität und auch Abgehobenenheit „der“ Geschichtsdidaktik nicht selten Kritik laut werden. Peter Schulz-Hageleit hat dies etwa im Zusammenhang mit der Kompetenzdebatte auf den Punkt gebracht: Der „akademische Diskurs“ habe sich zur „Liturgie“ entwickelt, „wenn nicht sogar zur Litanei […], in der jeder erst einmal sein persönliches Bekenntnis zur neuen Göttin Kompetenz ablegen muss, bevor er die Sachaufgaben und Schwierigkeiten des Lehrens und Lernens überhaupt anspricht“[3].
Es ist aber freilich unbestritten, dass viele KollegInnen keineswegs nur im luftleeren Raum agieren. Die kritisierte Hypostasierung sollte lediglich darauf hinweisen, dass wohl jeder unserer „Zunft“ manchmal die Bodenhaftung mehr oder weniger verliert. Ein Beitrag in einem Blogjournal braucht nun mal pointierte Formulierungen (ob sie gelingen, mögen andere beurteilen). Der Vorwurf, „die ältesten und uninformiertesten Alltagstheorien wieder“ aufzuwärmen, scheint daher in diesem Zusammenhang doch mehr als unangebracht. Zum einen sind Alltagstheorien bekanntlich durch ihren geringen Reflexionsgrad gekennzeichnet. Demantowsky gesteht mir aber immerhin zu, eine offenbar doch recht komplexe Metatheorie zu bemühen. Von einer Alltagstheorie kann daher keineswegs die Rede sein, vielmehr verstrickt sich Demantowsky hier selbst in einen Widerspruch. Zum anderen ist Vorsicht geboten, wenn Kritik von Seiten der LehrerInnen und Studierenden lediglich als Alltagstheorie abgetan wird. Damit kann durchaus eine gewisse Überheblichkeit verbunden werden, auch wenn dies Demantowsky wohl kaum bewusst intendiert.
Dass ich in meinen Ausführungen offenbar Michele Barricelli „unfair“ behandle, ist mir allerdings sehr unangenehm und – das gebe ich gerne zu – das Ergebnis eines zu schnell hingeschriebenen Satzes. Es war keineswegs intendiert, ihn als Beispiel für die Abgehobenheit „der“ Geschichtsdidaktik zu präsentieren. In seinem Beitrag schien mir nur eine gewisse Klage über das Unverständnis vieler LehrerInnen durchzuscheinen (was wohl wiederum eine Interpretation meinerseits darstellt). Selbstverständlich ist gegen die Erklärungen von Barricelli nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Allerdings kommen solche Erklärungen beim Adressaten oftmals nicht an. Über die Ursachen sollten wir nachdenken. Nichts anderes will der Text anregen.
Zusammenfassend gilt zu konstatieren: Ein Großteil der Kritik von Demantowsky und Heuer geht – zumal sie offenbar nur Fragmente des Textes erfasst haben – von falschen Voraussetzungen aus. Man möchte den beiden Kritikern ermutigend zurufen: Verzagt nicht! Lest den Text doch bitte noch einmal!
Anmerkungen:
[1] Eco, Umberto: Nachschrift zum „Namen der Rose“, 7. Auflage, München 1986, S. 14.
[2] Gadamer, Hans-Georg: Vom Zirkel des Verstehens. In: Ders.: Kleine Schriften, Bd. IV. Variationen, Tübingen 1977, S. 56f.
[3] Schulz-Hageleit, Peter: Schüler-Kompetenzen – Lehrerkompetenzen. Zwei divergente Zielperspektiven der historisch-politischen Fachdidaktik. In: Geißler, Christian / Overwien, Bernd: Elemente einer zeitgemäßen politischen Bildung. Festschrift für Prof. Hanns-Fred Rathenow zum 65. Geburtstag, Münster 2010, S. 111.