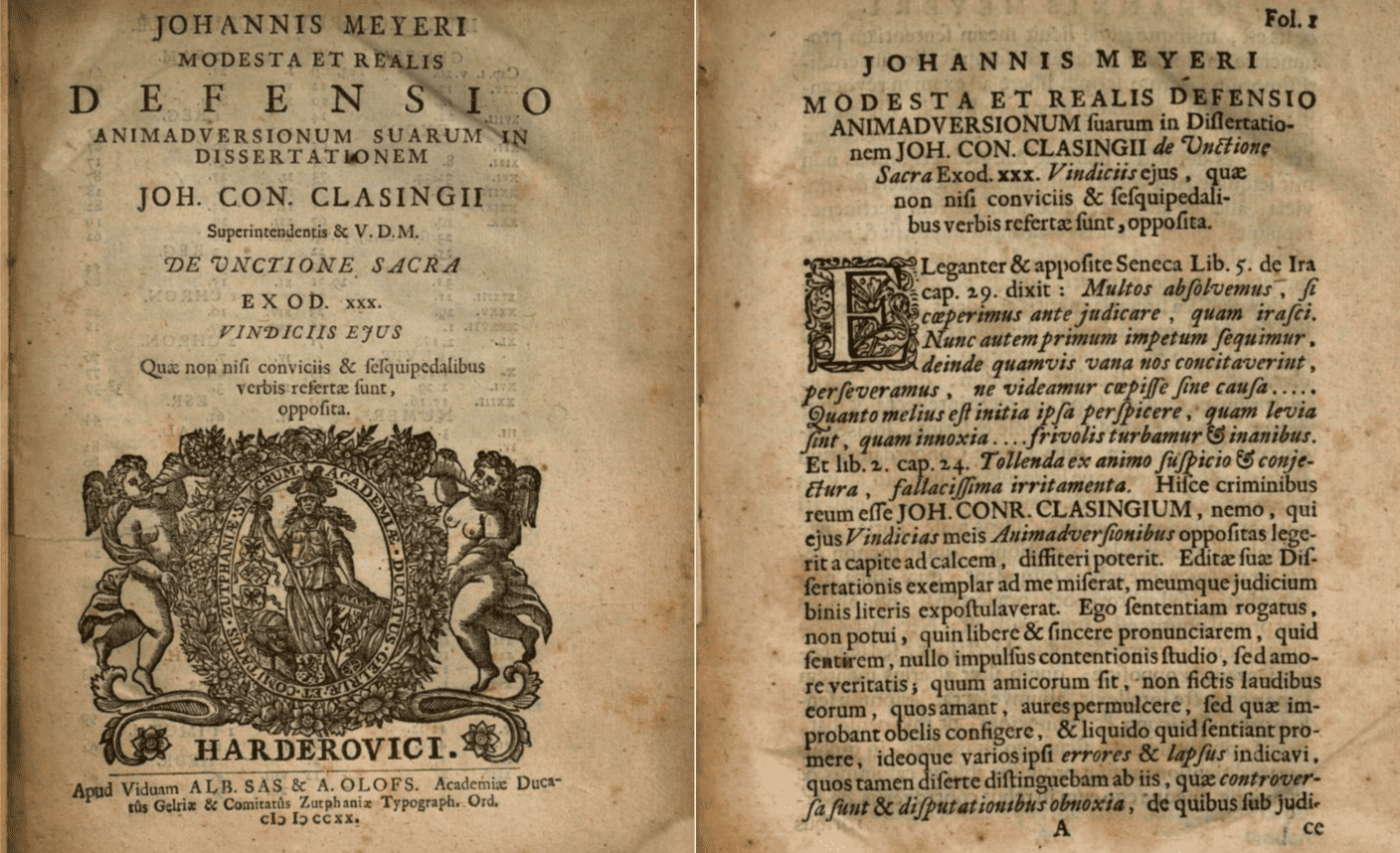
Abstract:
Forgetting is ill-reputed in history. It is meant to be suppressed, resisted and avoided. For historical subjects, institutions and processes, being forgotten seems to be synonymous with punishment, shame and disgrace. Forgetting, however, cannot be abolished by working on history. It is constitutive of any kind of engagement with historical materials. Historians always work with and on behalf of forgetting, and should be aware of this.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2022-19829
Languages: Deutsch, English
Wer war Johannes Meier? Ein Professor des späten 17. Jahrhunderts an der Universität Harderwijk. Jetzt, wo Sie das wissen, dürfen Sie es gern wieder vergessen. Warum? Weil es keinen Grund gibt, es sich zu merken. Meier bedient kein Erkenntnisinteresse. Niemand versucht, an seinem Beispiel eine historische Fragestellung zu beantworten. Oder doch? Was ist mit diesem Text? Und schon beginnt das Verhältnis zwischen Vergessen und historischer Forschung kompliziert zu werden…
Wozu Meier?
Wer war Johannes Meier (1650/51-1725)? Ein reformierter Theologe und Hebraist, Sohn eines Handwerkers, der in ärmlichen Verhältnissen in Blomberg in der Grafschaft Lippe geboren wurde und nach über 40 Jahren als Professor an der dortigen Universität im niederländischen Harderwijk starb. Soweit die spärlichen Informationen, die sich in Erfahrung bringen lassen, ohne ins Archiv zu müssen. Niemand kennt ihn, außer vielleicht einige wenige Spezialist:innen, und niemand interessiert sich für ihn. Dabei ist seine Lebensgeschichte nicht uninteressant. “Sein Armut konte die Begierde zum Studiren in ihm nicht dämpfen”, schrieb Christian Gottlieb Jöcher 1751.[1] Die Eltern wollten ihn nicht studieren lassen, also riss er mit 18 von zuhause aus. Er muss ein begabter junger Mann gewesen sein – es gelang ihm stets, Förderer zu finden, die ihm das Studium der Theologie und des Hebräischen ermöglichten.[2] Durch die Kriege Louis XIV. in die Niederlande verschlagen, wurde er mit 29 Professor und blieb es für den Rest seines Lebens.[3] Trotzdem ist er heutzutage vollkommen verstaubt und vergessen.
Jetzt gäbe es zwei klassische Möglichkeiten, damit umzugehen. Die erste: Meier daran zu messen und daraus, dass sich niemand mehr an ihn erinnert, abzuleiten, dass er das auch nicht wert sei, nichts Erinnernswertes geleistet habe. Wenn der Maßstab für historisch bedeutsame Leistungen sein sollte, dass sie ‛unvergesslich’ sind, dann ist alles, was dem Vergessen anheimfällt, unbedeutend. Dementsprechend wäre Meier keiner Erinnerung wert, die Vergessenheit die gerechte Strafe für seine Nichtsnutzigkeit.
Die zweite: Sich zu Meiers Anwalt zu machen und den Spieß umzudrehen. Seine Leistungen hervorzuheben, um zu zeigen, dass das Urteil der Nachwelt falsch war, dass er ohne Grund und ungerechterweise in Vergessenheit geraten sei und nun daraus gerettet werden müsse. Dafür müsste dann betont werden, warum er es auch heute immer noch wert sei, sich an ihn zu erinnern.
Hinsichtlich der Funktion des Vergessens macht es keinen Unterschied, welche dieser Möglichkeiten man wählt. Es bildet dabei das Gegenteil der historischen Arbeit, die dazu dient, es entweder aufzuheben, um Meier daraus zu retten, oder es zu benutzen, um Meier als jemanden zu bestimmen, der kein sinnvolles Objekt historischer Arbeit sein kann. Ob man die erste oder die zweite Möglichkeit wählt, hängt dann vor allem davon ab, welche Funktion Meier in der eigenen Argumentation haben soll.
Das ist der Punkt, an dem es unangenehm wird. Denn wenn das Vergessen und das Vergessene vor allem instrumentell als Folie funktionieren, vor deren Hintergrund die eigene Argumentation besser zur Geltung kommen soll, liegt der Verdacht nahe, dass es ein Objektivierungsproblem gibt. Sonst müsste es objektivierbare Kriterien geben, um zu bestimmen, ob Meier zu Recht oder zu Unrecht in Vergessenheit geraten sei. Dann läge es nicht mehr bei den jeweiligen Historiker:innen, diese Entscheidung zu treffen, sondern nur, zu klären, unter welchen Bereich Meier zu fallen hat. Diese Kriterien gibt es nicht – daher der Konjunktiv. Das wiederum liegt nicht daran, dass sie nur gefunden werden müssten, um dann angewandt werden zu können, sondern daran, dass es derartige objektivierbare Kriterien nicht gibt und nicht geben kann.
Die ausgeblendeten Dritten
Denn was misst die Rede vom zu Recht oder Unrecht Vergessenen? Die Relevanz, die dem jeweils als “vergessen” markierten Gegenstand zugesprochen werden soll. Was weiterhin relevant ist, soll nicht vergessen werden. Wir bedürfen seiner ja noch. Was nicht mehr relevant ist, kann und soll getrost vergessen sein und bleiben, denn es ist überflüssige Information.[4] In dieser Formulierung mit Bedacht unsichtbar gemacht, aber implizit enthalten ist der Ort der Bestimmung des Relevanten. Der liegt im Hier und Jetzt, bei den Beurteilenden. Relevant ist, was ich als Untersuchende:r in einen sinnvollen Bezug zu mir und meiner konkreten Situation bringen kann. Um diese Bezugnahme abstrahierend zu verallgemeinern: Was zu diesem Zeitpunkt in einen sinnvollen Bezug zur Allgemeinheit gesetzt werden kann, ist relevant. Der Ausdruck beschreibt notwendigerweise eine Beziehung. Wichtig ist etwas nicht an und für sich, sondern in Bezug auf eine bestimmte Gruppe zu einer bestimmten Zeit.[5] Was bedeutet, dass diese Kriterien sich mit der Zusammensetzung der Gruppe und ihrer zeitlichen Position ändern.[6] Relevanz wird im frühen 21. Jahrhundert anders beurteilt als zu Meiers Zeit im frühen 18. Jahrhundert, und was die Relevanzkriterien des frühen 24. Jahrhunderts sein werden, können wir uns nicht einmal vorstellen. Ich zumindest kann es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieselben sein werden wie die heutigen, ist aber sehr gering.
Ist das nicht bloß eine andere Formulierung der bereits im 18. Jahrhundert bekannten Standortgebundenheit von Historiker:innen? Das stimmt natürlich. Ist die Diskussion dann nicht redundant, weil mittlerweile selbstverständlich ist, dass historische Aussagen nur in ihrem zeitgenössischen Kontext angemessen beurteilt werden können? Durchaus nicht.
Denn wenn es keine objektivierbaren Kriterien gibt, heißt das nicht, dass es gar keine Kriterien geben könne. Ist das relevant, was ich in einen sinnvollen Bezug bringen kann, so muss ich angeben können, warum dieser Bezug sinnvoll ist. Ich muss transparent machen können, worin in diesem Bezug die Relevanz liegt, um meine Kriterien intersubjektivierbar machen können. Damit obliegt es mir aber auch, das zu tun, will ich wissenschaftliche Relevanz für meine Argumentation beanspruchen. Und zwar – und hier wird es wieder unangenehm – obliegt es mir, es explizit zu tun und es nicht implizit hinter der Generalklausel einer unaufhebbaren Standortgebundenheit zu verstecken.
Unangenehm ist das, weil es bedeutet, der eigenen Forschungspersönlichkeit einen unangemessen breit scheinenden Raum in der Arbeit einzuräumen. Auch Historiker:innen sind wissenschaftlich so sozialisiert, dass aus Gründen der Neutralität und Objektivität die Forscher:innen ganz hinter ihre Arbeit zurücktreten und in ihren Produkten unsichtbar sein sollen, um Transparenz zu gewährleisten. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, wenn so tatsächlich Methoden und Ergebnisse klar sichtbar werden und sich beurteilen lassen. In Fragen von “Erinnern” und “Vergessen” aber, deren Kriterien nur als dreiwertige Relationen zwischen Untersuchungsgegenstand, Untersuchungsmethode und Untersuchenden kontextualisiert werden können, ist echte Transparenz nicht möglich, wenn nur zwei Pole der Relation offengelegt werden.[7] Dass damit die Personen der Forschenden in einer Weise in ihre eigenen Untersuchungen einbezogen werden, die gewöhnungsbedürftig scheint, ist nicht zu ändern, wenn wir uns als Historiker:innen nicht einen Sonderstatus gegenüber den Personen zuschreiben wollen, deren Leben und Zeiten wir untersuchen. Da wir gleich ihnen im Kontext unserer Zeit handeln müssen, auch wenn wir historisch forschen, gibt es für einen solchen Sonderstatus keinen Grund.[8]
Wie bin ich also zu Johannes Meier gekommen? Zu Beginn meiner Arbeit über das Vergessen-Werden im Wissenschaftsbetrieb war Meier noch ein Kandidat für die Beispielfälle. Denn das Werden des Vergessens dingfest zu machen war nur exemplarisch möglich; es ging also um die Auswahl einiger weniger Beispielfälle. Johannes Meier, so vergessen er unzweifelhaft war, war dabei problematisch. Ich wollte Personen nachverfolgen, bei denen es nicht als gesetzt gelten konnte, dass sie in Vergessenheit gerieten. Das ließ sich bei Meier, all seiner Verdienste zum Trotz, bezweifeln. Außerdem wollte ich aus pragmatischen Gründen Personen wählen, die sich gut nachverfolgen ließen. Sie mussten in späteren Schriften einigermaßen leicht eindeutig zu identifizieren sein. Jemand mit gleich zwei Allerweltsnamen bot dafür denkbar schlechte Voraussetzungen. Beides zusammen genügten mir, um ihn von der Liste zu streichen.
Darf Meier vergessen werden? Ja, bitte!
Wenn ich also sage, dass Meier getrost vergessen sein und bleiben kann, dann bedeutet das nicht, dass er für andere Arbeiten aus anderer Perspektive nicht doch ein lohnender Gegenstand sein kann.
Damit öffnet sich der Fokus für die Betrachtung der Vorteile, die eine andere Behandlung des Vergessen denn als bloße Folie bringt. So tritt noch einmal deutlicher hervor, dass das Vergessen-Werden der historische und historiographische Normallfall ist. Von allen, die je lebten, und allem, was je geschah, ist der weitaus größte Teil vergessen. “Vergessen” heißt dabei nicht “verloren”! Historisch gesehen kann alles, wozu es historisches Material gibt, wieder erarbeitet werden: Es ist vergessen, solange das niemand tut, aber nicht verloren. Das wäre es erst, wenn auch das historische Material verloren wäre, sodass wir nicht mehr wissen könnten, was zu jener Zeit an diesem Ort der Fall war.[9] Der allergrößte Teil des historischen Materials ist noch nie von Historiker:innen bearbeitet worden – oder als irrelevant zur Seite gelegt worden, so wie Johannes Meier von mir. All das ist vergessen.
Es ist also für historische Akteur:innen und Ereignisse viel wahrscheinlicher, vergessen zu werden, als in dauerhafter Erinnerung zu bleiben – weil niemand diese Namen, Daten und Geschichten weiterträgt, und weil sich die Relevanzkriterien für das, was aus der Vergangenheit behandlungswürdig ist, beständig ändern. Es ist also nicht so, dass sich daraus ableiten ließe, vergessen zu werden sei Schande, Schmach oder Strafe für die Vergessenen. Es ist weniger erklärungs- und begründungsbedürftig als sein Gegenteil, das dauerhafte Erinnert-Werden, das üblicherweise aber stillschweigend normalisiert und als den jeweiligen Gegenständen gebührend und angemessen unhinterfragt hingenommen wird.
Das Vergessene ist damit der eigentliche Rohstoff für die Arbeit von Historiker:innen. Dort liegt das Material, das neue Perspektiven eröffnen kann, das noch nicht unter einem Berg von Interpretationen begraben oder zu vermeintlich fixen und unverrückbaren Daten und Fakten erstarrt ist. Das Vergessene erlaubt uns, neue sinnvolle Bezüge zwischen dem Vergangenen und uns selbst zu formulieren: und genau das ist unsere Aufgabe.
Und was ist jetzt mit Johannes Meier? – Vergessen Sie ihn! Bis auf Weiteres.
_____________________
Literaturhinweise
- Winnerling, Tobias. Das Entschwinden der Erinnerung. Vergessen-Werden im akademischen Metier zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert. Frühneuzeit-Forschungen, Band 22. Göttingen: Wallstein Verlag, 2021.
- Assmann, Aleida. Formen des Vergessens. Historische Geisteswissenschaften, Band 9. Göttingen: Wallstein Verlag, 2016.
- Connerton, Paul. How Modernity Forgets. 3rd printing. Cambridge, UK/New York: Cambridge University Press, 2013.
Webressourcen
- Publications by Johannes Meier (1651-1725) online available by 12 March 2022, compiled by Tobias Winnerling: https://public-history-weekly.degruyter.com/wp-content/uploads/2022/04/Webresource_Winnerling_-_Johannes_Meier_online_available.pdf (last accessed 25 May 2022).
- A list of Meier’s publications including the disputations he presided over can be accessed via Short Title Cataloge Netherlands (STCN): http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=7/TTL=168/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=YOP&TRM=Meyer%2C+Johannes&REC=* (last accessed 11 March 2022).
_____________________
[1] Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten Lexicon, Band 3 (M-R) (Leipzig:, 1751), 371-372.
[2] David van Hoogstraten, Groot algemeen historisch, geografisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, ed. Matthaeus Brouërius van Nidek, Band 7 (M-N) (Amsterdam, 1732), 197-198. https://archive.org/details/grootalgemeenhis07hoog/page/178/ (letzter Zugriff am 2. Mai 2022).
[3] O.A. “Meier (Johannes),” in: Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek, begr. von Jacobus Kok, Band 23 (M-P) (Amsterdam, 1790), 19-20.
[4] Peter Wehling, “Vom Nutzen des Nichtwissens, vom Nachteil des Wissens. Zur Einleitung,” in: Vom Nutzen des Nichtwissens. Sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven, ed. Peter Wehling (Bielefeld: transcript, 2014), 9-51, hier 11.
[5] Gerd Sebald, und Jan Weyand, “Zur Formierung sozialer Gedächtnisse. On the formation of social memory,” Zeitschrift für Soziologie 40, no. 3 (2011), 174-189, hier 183.
[6] Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, ed. Lothar Schäfer, und Thomas Schnelle, 12. Auflage (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2019), 53-54.
[7] Mark Bevir, The Logic of the History of Ideas (Cambridge / New York: Cambridge University Press, 1999), 33.
[8] Achim Landwehr, Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit. Essay zur Geschichtstheorie (Frankfurt a.M.: Fischer, 2016), 277.
[9] Oliver Dimbath, und Peter Wehling, “Soziologie des Vergessens. Konturen, Themen und Perspektiven,” in: Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder, ed. Oliver Dimbath, und Peter Wehling (Konstanz: UVK, 2011), 7-36, hier 17.
_____________________
Abbildungsnachweis
Johannis Meyeri Modesta et realis defensio animadversionum suarum in dissertationem Joh. Con. Clasingii © 1720, gemeinfrei.
Empfohlene Zitierweise
Winnerling, Tobias: Forget about Johannes Meier!. In: Public History Weekly 10 (2022) 4, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2022-19829.
Redaktionelle Verantwortung
Who was Johannes Meier? A late 17th century professor at the University of Harderwijk. Now that you know, please feel free to forget this fact. Why? Because there is no reason to remember it. Meier serves no epistemological interest. No one tries to answer any historical question by taking him as an example. Or do they? Well, what about this text? And that is how the relationship between forgetting and historical research begins to get complicated…
Why Meier?
Who was Johannes Meier (1650/51-1725)? A Reformed theologian and Hebraist, son of a craftsman, born to a poor family in Blomberg in the county of Lippe, and who died in the Netherlands after serving for over 40 years as a professor at the local university in Harderwijk. So much for the scant information that can be obtained without delving into the archives. Nobody knows about Meier, except perhaps a few specialists. Nor is anyone interested in him. Yet, his life story is not uninteresting. “His poverty could not dampen his desire to study,” wrote Christian Gottlieb Jöcher in 1751.[1] Meier’s parents did not want him to study, so he ran away from home at the age of 18. He must have been a gifted young man as he always managed to find sponsors who enabled him to study theology and Hebrew.[2] Displaced to the Netherlands by the wars of Louis XIV, he became a professor at 29 and remained one for the rest of his life.[3] Today, however, he is utterly antiquated and forgotten.
Now there are two classical ways of dealing with this. First: to compare Meier with the facts and to conclude from the fact that no one remembers him that he was not worth remembering, and that he achieved nothing worth remembering. If being “unforgettable” is meant to set the standard for historically significant achievements, then everything that falls prey to oblivion is insignificant. Accordingly, Meier would be undeserving of remembrance, and oblivion would be the just punishment for his fecklessness.
The second way of dealing with the fact is to make oneself Meier’s advocate and turn the tables on him. To highlight his achievements in order to show that he was judged wrongly by posterity, that he has been unjustly and unreasonably forgotten and now has to be rescued from oblivion. This would require emphasising why he should still be worth remembering today.
Regarding the function of forgetting, it makes no difference which of these possibilities one chooses. Forgetting functions as the opposite of historical work, which serves either to cancel out forgetting, to rescue Meier from being forgotten, or to use it to decide that Meier is unfit to serve as a meaningful object of historical work. Thus, whether one chooses the first or the second option depends primarily on Meier’s function in one’s argumentation.
Here, matters become awkward. For if forgetting and what is forgotten function chiefly instrumentally, as a background against which one’s argumentation is supposed to fair better, then we seem to have a problem of objectification on our hands. Otherwise, there would have to be objectifiable criteria to determine whether Meier has been justly or unjustly forgotten. It would then no longer be up to the respective historians to make this decision, but merely a matter of establishing where Meier fits in. These criteria do not exist — hence the subjunctive. This is not because they would first need to be found to be applied, but because such objectifiable criteria do not and cannot exist.
Hidden Third Parties
What does discussing what has been justly or unjustly forgotten measure? The relevance to be ascribed to the “forgotten” object. What is still relevant should not be forgotten. We still need it. What is no longer relevant may be forgotten, with a clear conscience. And rightly deserves to be because it is superfluous.[4] This wording carefully hides, but implies where and when what is relevant is determined as such. This time and place are the here and now. Establishing relevance (or not) is the responsibility of those assessing the past. What is relevant is what I, as a researcher, can meaningfully relate to myself and my present situation. Put in abstract and general terms: What can be meaningfully linked to the community (the public at large) at this point in time is relevant. The expression necessarily describes a relationship. Something is not important per se, but in relation to a particular group at a particular time.[5] Which means that the criteria of relevance will change depending on the composition of the group and its position in time.[6] Relevance is judged differently in the early 21st century than it was in Meier’s early 18th century. Nor can we imagine today what the relevance criteria of the early 24th century will be. Or at least I can’t. It is highly unlikely that they will be the same as today’s.
Is this not simply another way of saying that the historian is bound to time and place, an idea already familiar in the 18th century? That is of course true. So is the discussion redundant because it is self-evident by now that historical statements can only be adequately assessed in their contemporary context? Not at all.
Because the absence of objectifiable criteria does not mean that no criteria exist. If that which I can meaningfully relate to myself is relevant, I must be able to indicate why this relation is meaningful. I must be able to make transparent where relevance lies within this relation in order to make my criteria inter-subjectively understandable. And I must do so if I want to claim scientific relevance for my argumentation. Moreover, I must do so — and here matters again become unpleasant — explicitly rather than hide behind the blanket clause of the unalienable boundedness of my position.
This is unpleasant because it seems to amount to giving one’s own personality as a researcher inappropriately ample scope in one’s research. Historians, too, are socialized scientifically in such a way that, for reasons of neutrality and objectivity, they are supposed to retreat completely behind their work and to become invisible in their products, so as to ensure transparency. No objection —if this makes methods and results clearly visible and open to critical judgement. Regarding “remembering” and “forgetting,” however, whose criteria can only be contextualized as trivalent relations between the object of investigation, the method of investigation and the investigators, genuine transparency is impossible if only two poles of the relation are disclosed.[7] Involving researchers in their own investigations as persons in a way that seems a little unfamiliar cannot be avoided if we as historians do not want to ascribe to ourselves a special status vis-à-vis those whose lives and times we study. Since we, like them, need to act in the context of our time, even if we are doing historical research, there is no reason for such a special status.[8]
So why Johannes Meier? When I began researching how things are forgotten in academia, Meier was a possible example — because the processes of forgetting and being forgotten can be pinned down only by way of example. Thus it was a matter of selecting a few sample cases. Johannes Meier, forgotten as he undoubtedly was, proved problematic in this respect. I wanted to trace the trajectories of persons for whom falling into oblivion did not seem inevitable. Whatever his merits, this seemed doubtful in Meier’s case. Moreover, for pragmatic reasons, I wanted to select people who could be easily traced. They had to be reasonably easy to identify in later writings. Someone whose first and last name are both very common (in German) seemed like the worst possible choice. This was sufficient for me to delete him from the list.
Should Meier be forgotten? Yes, please!
If, as I have argued, Meier can very well be forgotten with a clear conscience, this does not mean that he may not prove a worthwhile subject for research from a different perspective.
This enables considering the advantages of treating oblivion as more than a mere backdrop. From such a perspective, it becomes even clearer that being forgotten is the historical and historiographical norm. Of all those who have lived, and of all that has happened, by far the largest part has been forgotten. “Forgotten” does not equal “lost” in this respect! From the perspective of historical research, everything on record (i.e. for which historical materials exist) can be raised from oblivion: as long as nobody bothers to do so, it will remain forgotten, but not lost. It would only be lost if the historical materials were also lost, as this would mean that nobody would ever know what happened at a particular place at a particular time.[9] The vast majority of historical materials have never been worked on by historians — or have been dismissed as irrelevant, as Johannes Meier was by me. All of that is forgotten.
It is thus much more likely for historical actors and events to be forgotten than to be remembered forever — because no one keeps alive these names, dates and stories, and because the relevance criteria for which past phenomena are worth dealing with are constantly changing. Being forgotten, then, need not necessarily mean shame, disgrace or punishment for what has fallen into oblivion. Being forgotten needs less explanation and justification than its opposite: constantly being remembered. As a rule, however, the latter phenomena are tacitly normalised and unquestioningly accepted.
Thus, what is forgotten is the historian’s raw material. Such material opens up new perspectives, as it has not yet been buried under a mountain of interpretations or frozen into supposedly fixed and immovable facts and dates. What is forgotten allows us to shape new meaningful correlations between what is past and our own present selves: and this precisely is our task.
So what about Johannes Meier? — Forget him! Until further notice.
_____________________
Further Reading
- Winnerling, Tobias. Das Entschwinden der Erinnerung. Vergessen-Werden im akademischen Metier zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert. Frühneuzeit-Forschungen, Band 22. Göttingen: Wallstein Verlag, 2021.
- Assmann, Aleida. Formen des Vergessens. Historische Geisteswissenschaften, Band 9. Göttingen: Wallstein Verlag, 2016.
- Connerton, Paul. How Modernity Forgets. 3rd printing. Cambridge, UK/New York: Cambridge University Press, 2013.
Web Resources
- Publications by Johannes Meier (1651-1725) online available by 12 March 2022, compiled by Tobias Winnerling: https://public-history-weekly.degruyter.com/wp-content/uploads/2022/04/Webresource_Winnerling_-_Johannes_Meier_online_available.pdf (last accessed 25 May 2022).
- A list of Meier’s publications including the disputations he presided over can be accessed via Short Title Cataloge Netherlands (STCN): http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.11/SET=7/TTL=168/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=YOP&TRM=Meyer%2C+Johannes&REC=* (last accessed 11 March 2022).
_____________________
[1] Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten Lexicon, Volume 3 (M-R) (Leipzig, 1751), 371-372.
[2] David van Hoogstraten, Groot algemeen historisch, geografisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, ed. Matthaeus Brouërius van Nidek, Band 7 (M-N) (Amsterdam, 1732), 197-198. https://archive.org/details/grootalgemeenhis07hoog/page/178/ (last accessed 2 May 2022).
[3] Anon. “Meier (Johannes),” in: Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek, begr. von Jacobus Kok, Volume 23 (M-P) (Amsterdam, 1790), 19-20.
[4] Peter Wehling, “Vom Nutzen des Nichtwissens, vom Nachteil des Wissens. Zur Einleitung,” in: Vom Nutzen des Nichtwissens. Sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven, ed. Peter Wehling (Bielefeld: transcript, 2014), 9-51, here 11.
[5] Gerd Sebald, und Jan Weyand, “Zur Formierung sozialer Gedächtnisse. On the formation of social memory,” Zeitschrift für Soziologie 40, no. 3 (2011), 174-189, here 183.
[6] Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, ed. Lothar Schäfer, und Thomas Schnelle, 12. Auflage (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2019), 53-54.
[7] Mark Bevir, The Logic of the History of Ideas (Cambridge / New York: Cambridge University Press, 1999), 33.
[8] Achim Landwehr, Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit. Essay zur Geschichtstheorie (Frankfurt a.M.: Fischer, 2016), 277.
[9] Oliver Dimbath, und Peter Wehling, “Soziologie des Vergessens. Konturen, Themen und Perspektiven,” in: Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder, ed. Oliver Dimbath, und Peter Wehling (Konstanz: UVK, 2011), 7-36, hier 17.
_____________________
Image Credits
Johannis Meyeri Modesta et realis defensio animadversionum suarum in dissertationem Joh. Con. Clasingii © 1720, Public Domain.
Recommended Citation
Winnerling, Tobias: Vergesst Johannes Meier!. In: Public History Weekly 10 (2022) 4, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2022-19829.
Editorial Responsibility
Copyright © 2021 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact the editor-in-chief (see here). All articles are reliably referenced via a DOI, which includes all comments that are considered an integral part of the publication.
The assessments in this article reflect only the perspective of the author. PHW considers itself as a pluralistic debate journal, contributions to discussions are very welcome. Please note our commentary guidelines (https://public-history-weekly.degruyter.com/contribute/).
Categories: 10 (2022) 4
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2022-19829
Tags: Early Modern Period (Frühe Neuzeit), History of Historiography, Knowledge (Wissen), Oblivion (Vergessen)
German version below. To all readers we recommend the automatic DeepL-Translator for 22 languages. Just copy and paste.
OPEN PEER REVIEW
Forgetting/remembering and the epistemological Foundations
I was interested to read that Johannes Meier can be safely forgotten. I completely agree with the author: not everything that has happened needs to be remembered. The mere fact that something has not yet been researched is not an argument that it needs to be researched. Some people, events, processes and phenomena have never been discussed because they seemed and still seem unimportant and uninteresting to historians.
The question of whether something is worth remembering or not is the result of a (more or less conscious) evaluation and is based not least on comparative practices: one phenomenon is more important, more significant, more interesting than another. The new comparative research[1] has worked out very clearly that comparisons do not lead to objective results: The comparative insights (tertia) do not arise quasi-naturally from the comparative units (comparata), but are chosen. Whether the comparison of meanings, which decides on forgetting and remembering, is made from a political, economic, everyday or gender history perspective, will determine the choice of tertia; and from this results whether something is mentioned at all in the historiographical investigation or even given an important position in the respective historical argumentation.
As the author conclusively points out, historical significance is decided in the present. Memorability cannot therefore be determined “objectively” in the object and can change over time. In “questions of ‘remembering’ and ‘forgetting’, however, whose criteria can only be contextualised as a three-valued relation between object of investigation, method of investigation and investigator,” the author concludes, “genuine transparency is not possible”.
This is where I would like to interject; not to directly contradict the text, but to add an important aspect to it. Certainly, true transparency is not possible. But are there not patterns in our evaluation that could very well be revealed transparently? Forgetting and remembering are not only “two basic categories of historical consciousness” (Hölscher, 1989, 3), they also reflect and reproduce power positions. The negotiation of power relations and power of definition in relation to memory and forgetting is very clear in the current debates about monument demolitions, especially in the context of the Black Lives Matter movement, but also in the banning of some literature in US states that is understood as too liberal.
Exclusion from the value of memory and shifting into the realm of the forgotten also happens beyond the current and noisy politics of the day – especially in the conceptualisation of history. Some of the underlying evaluation criteria have been so hegemonically represented for so long that they have almost sedimented into natural categories: The classical definition of politics focused entirely on the outer world, the realm of the male, demarcated from the inner, familial, intimate, in which the female operates.
The 19th century concept of politics writes women out of the political sphere of pre-modernity and assigns politically active women to the realm of oblivion, allowing at most individual exceptional figures (Catherine II, Elizabeth I, Maria Theresa, Queen Luise) – with a corresponding gender-specific construction performance as an exceptional phenomenon.[2] In comparative theory terms, the majority of women are deprived of comparability, they are excluded a priori from comparison, what is worth remembering and what is not. This view is reinforced all the more because it is linked to narratives of progress and modernisation: Women who are now increasingly successful in politics prove to large parts of the population how modern and civilised we are today. Our own progress in civilisation is threatened by the memory of earlier women who were politically successful in the Ancien Regime.[3]
The same is often true of professionalisation processes, which on the one hand ‘actually’ expelled women from central social fields (e.g. medicine or historiography)[4]. At the same time, however, earlier protagonists of these fields had to be virtually forgotten in order to prove the success of professionalisation. Early women’s history has tried to bring the many forgotten women back to light and has also been ridiculed in the process.[5] As much as gender-historical or post-colonial critiques have made us sensitive, women or people of colour are only rarely intentionally forgotten anymore, still there is a great, inherent potential for forgetting in our classical and established concepts.
Similar fundamental, and in some cases epistemological, exclusion can be found in many groups that have been struggling in recent years and decades to be seen in our society under the label of diversity. These contemporary struggles are often linked to historical arguments. So often there is the circular argument that if these groups did not exist in the past, they are more of a liberal fad. The lack of remembered depth can give rise to contestation of current equality claims. Hermaphrodites are an element of early modern medical and also ethnographic discourses, but hardly of everyday history studies. Disability studies struggles to find source terms for its object of study.[6]
We do not know, as the author writes, what memory structures of coming centuries will be like. This does not only result from contemporary standards of evaluation, but their development is pre-structured by outdated conceptualisations and sedimented patterns of meaning. And when the past provides the historical arguments for the present, we historians must always pay special attention.
Further Reading
_____
[1] Cf. the work of the SFB 1288 Practices of Comparison. Ordering and Changing the World (last accessed 5 May 2022).
[2] Cf. Ulbrich 2011 for the premodern social hierarchy; more generally on the concept of the political: Frevert 2005.
[3] I am arguing here with binary gender roles because in the Middle Ages and the early modern period, the times I am primarily referring to, and before the biologisation of discourse, an exclusively performatively constructed binarity prevailed. Other forms of sexual orientation, as well as biological diversity, existed as a matter of course, but do not appear as relevant socially or even for individual identity formation. Certainly, the argument I developed in the following can be applied to the gender diversity of people, but not to the question of identity formation, belonging or self-fashioning.
[4] Cf. on medicine: Flüchter 2020; on historiography: Epple 2003.
[5] E.g. Flüchter-Sheryari/Perrefort 2001; Lundt 1992.
[6] Cf. the research group DisAbility Studies at the University of Vienna, founded by Julia Gebke and Julia Heinemann: https://disabilitystudies.univie.ac.at/ (last accessed 5 May 2022).
_________
Vergessen/ Erinnern und die epistemologischen Grundlagen
Interessiert habe ich gelesen, man könne Johannes Meier getrost vergessen. Dem Autor ist völlig zuzustimmen: nicht an alles Geschehene muss erinnert werden. Alleine, dass etwas noch nicht erforscht wurde, ist eben noch kein Argument, dass es erforscht werden muss. Über manche Personen, Ereignisse, Prozesse und Phänomene wurde noch nie gesprochen, weil sie der Geschichtswissenschaft unwichtig und uninteressant erschienen und erscheinen.
Die Frage, ob etwas der Erinnerung wert ist oder nicht, ist das Ergebnis einer (mehr oder weniger bewussten) Bewertung und beruht nicht zuletzt auf Vergleichspraktiken: Ein Phänomen ist wichtiger, bedeutungsvoller, interessanter als ein anderes. Die neue Vergleichsforschung[1] hat sehr deutlich aufgearbeitet, dass Vergleiche eben nicht zu objektiven Ergebnissen führen: Die Vergleichshinsichten (tertia) ergeben sich eben nicht quasi-natürlich aus den Vergleichseinheiten (comparata), sondern werden gewählt. Ob man aus einer politik-, wirtschaftshistorischen, einer alltags- oder geschlechtergeschichtlichen Perspektive den Bedeutungsvergleich anstellt, der über Vergessen und Erinnern entscheidet, wird die Wahl der tertia bestimmen; und daraus ergibt sich, ob etwas in der geschichtswissenschaftlichen Untersuchung überhaupt erwähnt oder gar eine wichtige Position in der jeweiligen historischen Argumentation erhält
Wie der Autor schlüssig herausarbeitet, wird über historische Bedeutung in der Gegenwart entschieden. Erinnerungswürdigkeit ist also nicht „objektiv“ im Objekt festzustellen und kann sich über die Zeit verändern. In „Fragen von ‚Erinnern‘ und ‚Vergessen‘ aber, deren Kriterien nur als dreiwertige Relation zwischen Untersuchungsgegenstand, Untersuchungsmethode und Untersuchenden kontextualisiert werden können,“ so schließt der Autor, ist „echte Transparenz nicht möglich“.
Hier möchte ich einhaken; dem Text nicht direkt widersprechen, ihn aber doch um einen wichtigen Aspekt ergänzen. Sicherlich ist keine echte Transparenz möglich. Gibt es aber nicht doch Muster in unserer Bewertung, die man sehr wohl transparent aufdecken könnte? Vergessen und Erinnern sind nicht nur „zwei Grundkategorien des historischen Bewußtseins“ (Hölscher, 1989, 3), sie spiegeln und reproduzieren auch Machtpositionen. Das Aushandeln von Machtverhältnis und Definitionsmacht bezogen auf Erinnerung und Vergessen ist bei den derzeitigen Debatten um Denkmalstürze gerade im Kontext der BlackLivesMatter-Bewegung sehr deutlich, aber auch bei dem Verbot mancher als zu liberal verstandener Literatur in US-amerikanischen Bundesstaaten.
Exklusion aus dem Erinnerungswerten und Verschiebung in den Bereich des Vergessenen geschieht auch jenseits der aktuellen und lauten Tagespolitik – gerade in der geschichtswissenschaftlichen Begriffsbildung. Manche der zugrundeliegenden Bewertungskriterien wurden so lange so hegemonial vertreten, dass sie geradezu zu natürlichen Kategorien sedimentiert sind: Die klassische Definition des Begriffs Politik setzte ganz auf das äußere Welt, den Bereich des Mannes, abgegrenzt von dem Inneren, Familiären, Intimen, in dem die Frau agiert.
Der Politik-Begriff des 19. Jahrhunderts schreibt Frauen aus der politischen Sphäre der Vormoderne heraus und weisen politisch agierende Frauen dem Reich des Vergessens zu, lassen höchstens einzelne Ausnahmegestalten (Katharina II., Elisabeth I., Maria Theresia, Königin Luise) zu – mit entsprechender geschlechtsspezifischer Konstruktionsleistung als Ausnahmeerscheinung.[2] Die Mehrheit der Frauen wird vergleichstheoretisch gesprochen, die Vergleichbarkeit entzogen, sie werden a priori von dem Vergleich ausgeschlossen, was ist erinnerungswürdig und was nicht. Diese Sicht verstärkt sich umso mehr, weil sie sich mit Fortschritts- und Modernisierungserzählungen verbinden: Mittlerweile vermehrt in der Politik erfolgreiche Frauen beweisen für weite Teile der Bevölkerung, wie modern und zivilisiert wir heute sind. Dieser eigene Zivilisierungsfortschritt droht durch das Erinnern an frühere, im Ancien Regime politisch erfolgreiche Frauen, ins Wanken geraten.[3]
Ähnlich verhält es sich häufig mit Professionalisierungsprozessen, durch die Frauen einerseits ‚real‘ aus zentrale gesellschaftliche Bereiche ausgewiesen wurden (z. B. der Medizin oder der Geschichtswissenschaft[4]). Zugleich mussten aber auch frühere Protagonisten dieser Felder geradezu vergessen werden, um den Erfolg der Professionalisierung zu belegen. Die frühe Frauengeschichte hat versucht, die vielen vergessenen Frauen wieder ans Licht zu bringen und ist damit auch belächelt worden.[5] So sehr uns geschlechtergeschichtliche oder auch postkoloniale Kritik sensibel gemacht haben, Frauen selbstredend kaum mehr intentional vergessen werden, liegt ein großes, inhärentes Vergessenspotential in unseren klassischen und etablierten Begriffen.
Ähnliche fundamentale, teils auch epistemologische Ausgrenzung findet sich bei vielen Gruppen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten um das Gesehen-Werden in unserer Gesellschaft unter dem Label der Diversität kämpfen. Diese gegenwärtigen Kämpfe sind oft verbunden mit historischen Argumenten. So oft gibt es den Zirkelschluss, wenn es diese Gruppen in der Vergangenheit nicht gab, sind sie eher eine liberale Modeerscheinung. Die fehlende erinnerte Tiefe kann zur Bestreitung der gegenwärtigen Gleichheitsansprüche geben. Hermaphroditen sind ein Element der medizinischen und auch ethnographischen Diskurse der Frühen Neuzeit, aber kaum der alltagsgeschichtlichen Untersuchungen. Die Disability-Studies kämpfen mit der Suche nach Quellenbegriffen für ihren Untersuchungsgegenstand.[6]
Wir wissen nicht, wie der Autor schreibt, wie Erinnerungsstrukturen kommender Jahrhunderte sein werden. Das ergibt sich aber nicht nur aus zeitgenössischen Bewertungsmaßstäben, sondern deren Entwicklung werden durch überkommenen Begriffsbildungen und sedimentierten Bedeutungsmuster, vorstrukturiert. Und wenn die Vergangenheit die historischen Argumente für die Gegenwart liefert, müssen wir Historiker:innen stets ganz besonders aufpassen.
Literaturempfehlungen
_____
[1] Vgl. die Arbeiten des SFBs 1288 Praktiken des Vergleichens. Die Welt ordnen und verändern (https://www.uni-bielefeld.de/sfb/sfb1288/) (letzter Zugriff 5. Mai 2022).
[2] Vgl. Ulbrich 2011 für die ständische Gesellschaft; allgemeiner zum Begriff des Politischen: Frevert 2005.
[3] Ich argumentiere hier mit binären Geschlechterrollen, da im Mittelalter und der Frühen Neuzeit, also den Zeiten, auf die ich mich vor allem beziehe, und vor der Biologisierung des Diskurses eine ausschließlich performativ konstruierte Binarität vorherrschte. Andere Formen der sexuellen Orientierung, ebenso wie biologische Diversität existierte selbstredend, treten aber nicht gesellschaftlich oder auch für die individuelle Identitätsbildung als relevant in Erscheinung. Sicherlich ist auf die geschlechtlich diverse Vielfalt der Menschen mein im Folgenden entwickeltes Argument anzuwenden, aber eben nicht auf die Frage der eigenen Identitätsbildung, Zugehörigkeit oder auch des Self-Fashionings.
[4] Vgl. zur Medizin: Flüchter 2020; zur Geschichtswissenschaft: Epple 2003.
[5] Z.B. Flüchter-Sheryari/Perrefort 2001; Lundt 1992.
[6] Vgl. die Forscher:innengruppe DisAbility Studies an der Uni Wien, gegründet von Julia Gebke und Julia Heinemann: https://disabilitystudies.univie.ac.at/ (letzter Zugriff 5. Mai 2022).
To all readers we recommend the automatic DeepL-Translator for 22 languages. Just copy and paste.
A thoughtful addition to my arguments! Let me just take the opportunity to put one thing a bit into perspective: My aim was not to deny that transparency can ever be achieved. I was rather wanting to stress that it cannot be achieved by standard historiographical methodology as it stands now.
The quoted sentence ends, in full, “genuine transparency is impossible if only two poles of the relation are disclosed.” So what seems to be a genuine epistemological issue here is to introspectively reflect on the own position as a historian writing the history already in writing the history, and doing so explicitly, to make clear which positions and presuppositions were at work in shaping the judgements made.
The third pole of the relation, that is, we as historians-at-work, may not be dismissed as neutral to the observation out of hand. A mere triviality given the level of reflection historical methodology has achieved so far, one should think; but the actual practices of historical work and writing still posit the opposite.
I fully concur that drawing arguments for current issues from history needs to awaken the historian’s suspicion. I only would like to add that this should also cover historiography as a current scientific practice, and thus us ourselves, for the sake of transparency.
To all readers we recommend the automatic DeepL-Translator for 22 languages. Just copy and paste.
Formen von Relevanz
Das sind sehr interessante Reflektionen über die Role des Vergessens in der Geschichtswissenschaft! Auch dass des Vergessens wegen an den obskuren Professor Johannes Maier erinnert wird, ist eine schöne Pointe, die mich wiedermal an den etwas aus der Mode gekommenen Begriff der Dialektik hat denken lassen. (Und es ist wohl kein Zufall, dass diese auch in Marko Demantowskys Einleitung zum Thema vorkommt.)
Bevor ich auf die mich hier eigentlich interessierende Frage der Relevanz zu sprechen komme, noch ein kurzer Kommentar zum Stellenwert des Vergessens in der historischen Arbeit, den mir Winnerling stellenweise etwas überzubetonen scheint. Etwa wenn es im englischsprachigen Abstract heisst, “historians always work on behalf of forgetting”.
Das ist eine noch stärkere Aussage, als dass Vergessen “constitutive of any kind of engagement with historical materials” sei, wie es auch im Abstract steht (und womit ich tendenziell übereinstimme).
Auch die Formulierung, dass das Vergessen “der eigentliche Rohstoff fuer die Arbeit von Historiker:innen” sei, wie es am Ende des Textes heisst, schlägt in diesselbe Kerbe.
Mein Problem mit diesen Aussagen ist, dass Historiker:innen nicht nur Vergessenes wieder in Erinnerung rufen – und konzeptionell muss etwas, das vergessen worden ist, zuvor schon mal gewusst worden sein –, sondern dass sie auch noch noch nie Gewusstes zu Tage fördern. Das mag in vielen Fällen ein vernachlässigbarer Unterschied sein; in anderen ist er es nicht, denke ich. Etwa wenn Historiker:innen ihre temporale Positionierung in der Zukunft der von ihnen beschriebenen Gegenstände und Prozesse dazu nutzen, diese in einer Art und Weise zu beschreiben, wie es Zeitgenoss:innen nicht hätten tun koennen (oder im Falle der Naturgeschichte).
Darüber hinaus stimme ich zu, dass “Ist Jemand zu Recht in Vergessenheit geraten?” keine wissenschaftlich-historiographische Frage ist, und es dementsprechend keine (weithin akzeptierten) Objektivierungskriterien dafür gibt.
Daraus folgt aber nicht, dass Relevanz rein “präsentistisch” zu definieren wäre, wie Winnerling es zu tun scheint. Relevant ist, schreibt er, “was ich als Untersuchende:r in einen sinnvollen Bezug zu mir und meiner konkreten Situation bringen kann”; ausserdem was “in einen sinnvollen Bezug zur Allgemeinheit gesetzt werden kann”.
Das scheinen mir zwei unterschiedliche Definitionen von Relevanz zu sein, einmal definiert durch den sinnvollen Bezug zu mir selbst und einmal durch eine nicht weiter definierte Allgemeinheit. Dass diese nicht deckungsgleich sein müssen, steht für mich außer Frage, es sein denn, der “sinnvolle Bezug” wäre so weit definiert, dass damit gemeint ist, dass, was als relevant befunden wurde, zuerst irgendwie verständlich sein muss. Könnte es nicht mal im Ansatz begriffen werden, könnte es auch nicht als relevant gedacht werden, soweit ja.
Daraus folgt aber nicht, dass sich alle Formen von Relevanz mit den Zeiten und den den jeweils Relevanz Zuschreibenden fortwährend ändern muessten, wie Winnerling dann weiter ausführt.
Ich denke hier im Speziellen an kausale Relevanz, die nicht vom sinnvollen Bezug zu mir in meiner Gegenwart oder zu einer gegenwärtigen Allgemeinheit abhängt (erneut: unter der Voraussetzung, dass wir “sinnvollen Bezug” nicht so weit fassen, dass jedes prinzipielle “Verstanden-werden-können” schon darunter fällt).
Was kausale Relevanz zumindest angeht, lässt sich dann also schon von objektiven Kriterien sprechen, wobei objektiv hier heisst, dass die Relevanzzuschreibungen vom Objekt stammen, nicht dass sie einfach so vorliegen oder von allen geteilt wuerden (womit ich mir damit natürlich die Frage einhandle, wie wir zu diesen Zuschreibungen kommen können und wie die Kriterien selbst gerechtfertigt werden können).
Aber vielleicht ist für diese Form der “objektiven kausalen Relevanz”, wie ich sie mir vorstelle, in Winnerlings Theorie auch Platz, genauer: in den “dreiwertigen Relationen zwischen Untersuchungsgegenstand, Untersuchungsmethode und Untersuchenden”, die Historiker:innen nach ihm explizit machen sollen. Falls es zu diesem Punkt weitere Arbeiten des Autors oder von anderen gibt, wuerde ich gerne davon hören. Eine echte Schande, würde ich es wieder vergessen!
To all readers we recommend the automatic DeepL-Translator for 22 languages. Just copy and paste.
Mir ging es zunächst um eine Diskussion des handwerklichen Standards, weniger um die epistemologischen Grundannahmen, die regeln, wie Phänomene zu verknüpfen sind. Nichtsdestotrotz lässt sich, wie der Kommentar deutlich macht, das eine nicht ohne das Andere betrachten. Dabei tritt ein Grundproblem zutage, mit dem ich mich zwar auch schon seit einer Weile intensiver beschäftige, aber bislang noch ohne druckfähige Ergebnisse: das der historischen Kausalität. Denn als Historiker:innen nehmen wir es zwar als ausgemacht an, dass Geschichte mehr ist als Dinge, die lediglich aufeinander folgen. Wir wollen ja nicht nur Chronist:innen sein, die bloß beschreiben, sondern auch – so der Kommentar – neues Wissen generieren, das sich eben nicht in dem erschöpft, was das Material darbietet.
Insofern ist völlig zuzustimmen, wenn gesagt wird, das Vergessene umfasse nicht alles, was Geschichtsschreibung ausmacht. Denn sonst bestünde deren Tätigkeit ja bloß im Referieren. Wenn wir Interpretationen vorlegen wollen, also Vorschläge für neues historisches Wissen unterbreiten, muss aber mehr dazugehören. Dinge müssen nicht nur aufeinander folgen, sondern auch auseinander; bestimmte historische Phänomene müssen in Ursache-Wirkungs-Beziehungen zueinander stehen (möglicherweise sogar alle historischen Phänomene).
Nur: Bislang hat es noch niemand vermocht, einen konsensfähigen Vorschlag dafür vorzulegen, wie diese Art der kausalen Verknüpfung in historischer Perspektive gelingt. Erstens ist keineswegs klar, wie festgestellt werden kann, welche dieser Dinge nicht bloß aufeinander, sondern auseinander folgen sollen, zwischen welchen historischen Phänomenen also nicht-triviale Beziehungen bestehen. Und zweitens ist mindestens ebenso unklar, auf welche Weise diese Dinge auseinander folgen sollen, wenn denn einmal klar wäre, dass sie das tun. Über die Natur solcher nicht-trivialer Beziehungen zwischen historischen Phänomenen lässt sich ebenso trefflich streiten wie über die Zuordnung zu diesen Beziehungen. Wir stehen damit, ehrlich gesagt, immer noch nicht besser da als Kant, als er die dritte Antinomie der kritischen Vernunft skizzierte.[1]
Die Frage nach der historischen Kausalität ist damit immer die, ob die menschengemachte Geschichte jenseits naturgesetzlicher Denkmodelle verstanden werden kann – oder nicht. Und falls sie das werden kann, welche Arten „praktischer Regeln“ dann angenommen werden müssten, um dieser anderen Kausalität Herr werden zu können.[2]
Vorschläge gibt es in Menge, allein wirklich tragfähig scheint keiner zu sein. Dass die Debatte so lange ergebnislos andauert, könnte bereits ein Indiz dafür sein, dass die Frage falsch gestellt sein mag. Bei der Vorstellung, Geschichte sei ein Geflecht kausaler Verknüpfungen, handelt es sich historisch gesehen ja zunächst einmal auch um ein erklärungsbedürftiges kulturgeschichtliches Phänomen mit einer langen Entwicklungsgeschichte (aber wäre es statthaft, diese Entwicklungsgeschichte kausal zu denken und damit bereits eine bestimmte Lesart implizit vorzugeben?). Soweit möchte ich nicht gehen, möchte aber – und das wäre die langatmige Antwort auf die eigentliche Frage – die “objektiven Verknüpfungen” erst einmal problematisieren, anstatt sie voraussetzungslos anzunehmen. Und das würde bedeuten, um weiter in der Sprache meines Vorschlags zu reden, dass zu den Voraussetzungen, die transparent gemacht werden müssten, auch die eigenen Vorannahmen über die Natur objektiver historischer Verknüpfungen gehören müssten. Woraufhin diese dann natürlich eingeführt werden können, um neues Wissen zu generieren, das hoffentlich lange im Umlauf bleibt, ohne in Vergessenheit zu geraten.
—–
[1] Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, hg. von Ingeborg Heidemann, Stuttgart 1998, S. 490.
[2] Vgl. Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft, hg. von Joachim Kopper, Stuttgart 1998, S. 34–36.
To all readers we recommend the automatic DeepL-Translator for 22 languages. Just copy and paste.
Volle Zustimmung, dass wir “objektive Verknüpfungen”, wie ich sie als kausale hier eingebracht habe, weiter problematisieren sollten. Hier also der Versuch einer weiteren Annäherung, indem ich etwas genauer angebe, was (historische) Kausalität wohl nicht ist, welche Konzepte von Kausalität also getrost vergessen werden koennen, und was sie vielleicht sein koennte, da es in der philosophischen Diskussion darüber in den letzten Jahren durchaus Fortschritte gegeben hat. (Ich glaube also nicht, dass die Debatte um die historische Kausalität, wie Winnerling schreibt, schon “so lange ergebnislos andauert”.)
Zwei Dinge bringen uns bei der Frage um historische Kausalität nicht weiter, denke ich: die a-kausale “history is just one damn thing after another”-Ansicht (als Phrase Toynbee zugeschrieben, der, oh Ironie, eine 12-bändige Weltgeschichte vorgelegt hat) und die traditionelle Hume’sche Vorstellung von Kausalität, die oft als “Regularitätstheorie” der Kausalität bezeichnet wird (“Wenn A, dann B”). Was beiden Positionen, was die Geschichte angeht, wenig anfängliche Plausibilität verleiht, ist, dass in unserem Alltagsverständnis und auch im (Vor-)Verständnis vieler (der meisten?) Historiker:innen geschichtliche Prozesse einer gewissen Logik folgen, sie aber keine (strikten) Regularitäten kennen. Nun könnten “wir” mit diesem Vorverständnis falsch liegen und die a-kausale Position könnte bei genauerer Hinsicht richtig sein; dem Versuch der historischen Kausalität auf die Spur zu kommen, liefert es aber Motivation und Legitimation.
Winnerling verlangt weiter zu Recht, dass jede Theorie historischer Kausalität zwei Dinge angeben können muss: a) was Kausalität ist; und b) wie wir zu Kausalaussagen über die Vergangenheit kommen können, sobald wir wissen, was diese ist. Was a) anlangt, möchte ich zwei Vorschläge machen, die momentan in der Geschichtsphilosophie diskutiert werden; bezüglich b) einen Weg angeben, auf dem wir uns dieser Frage nähern können.
Die zwei Theorien historischer Kausalität, die nicht-Hume’sch sind und mir vielversprechend erscheinen, sind: α) kontrafaktische Kausalitätstheorien und β) mechanismische.(1) Was das Wissen um solche Kausalbeziehungen in der Vergangenheit angeht, führt, denke ich, kein Weg daran vorbei, uns historiographische Texte und Forschungspraktiken genau anzusehen, um verstehen zu können, wie diese Kausalaussagen rechtfertigen, wie weit diese Rechtfertigungen reichen und ob sie etwas taugen. Was ich hier angebe, ist also nicht mehr als Forschungsprogramm, das in der Geschichtsphilosophie seiner Umsetzung harrt. Was wir momentan aber immerhin schon haben, sind vielversprechende explizite Kausalitätsverständnisse, die den Intuitionen von Historiker:innen und Laien zu entsprechen scheinen, sowie eine “Methode”, diese mit der Geschichtswissenschaft abzugleichen.
Anmerken möchte ich noch, dass ich kein “kausaler Absolutist” bin. Während ich glaube, dass historische Texte kausale Aussagen enthalten und diese zu den zentralen “epistemischen Gütern” gehören, die die Geschichtswissenschaft zu offerieren hat, glaube ich nicht, dass historiographische Texte nur aus diesen bestünden oder dass alle Begriffe, Entitäten und Prozesse, die Historiker:innen einführen, kausal verstanden werden könnten. Wie weit die “kausale Grundierung” der Geschichtswissenschaft reicht, ist für mich eine offene Frage, die durch das gerade skizzierte Forschungsprogramm hoffentlich beantwortet werden kann.
_____
(1) Zum kontrafaktischen Kausalitätsverständis siehe Virmajoki, V. (2022) “What Should We Require from an Account of Explanation in Historiography?” Journal of the Philosophy of History 16 (1), 22-53 (https://brill.com/view/journals/jph/16/1/article-p22_2.xml); zum mechanismischen Verstaendnis mein paper Gangl, G. (2021) “Narrative Explanations. The Case for Causality” Journal of the Philosophy of History 15 (2), 157-181 (https://brill.com/view/journals/jph/15/2/article-p157_3.xml).
To all readers we recommend the automatic DeepL-Translator for 22 languages. Just copy and paste.
Die Kausalität und die Strukturen des Vergessens
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, die scheinbare Abschweifung vom ‚eigentlichen‘ Thema einzuordnen und noch einmal den Bogen zurück zur Ausgangsfrage zu schlagen. Denn es lässt sich ja fragen, was das Reden über historische Kausalität(en) mit dem Vergessen zu tun haben soll. Ich glaube: Sehr viel.
Meine Forderungen nach methodisch kontrollierter Perspektivität in der Behandlung historischer Gegenstände aus dem Eingangsbeitrag sind Ergebnisse meiner Beschäftigung mit dem Vergessen. Allerdings wohlgemerkt nicht mit einem unspezifischen Vergessen an und für sich, sondern genauer gesagt mit einem strukturellen Vergessen, das auf der Ebene sozialer Gruppen stattfindet. Es befindet sich also auf der Mittelebene zwischen dem individualpsychologischen Geschehen, das nur selten überhaupt historiographisch beobachtbar wird, und dem als solches gar nicht beobachtbaren Gesamtkollektiv.
Die Frage dahinter war die, die durch die Rede vom „strukturellen Vergessen“ bereits impliziert wird: Ob sich Vergessen eben nicht nur auf struktureller Ebene abspiele und beobachten lasse, sondern vor allem, ob es selbst Strukturen unterliege. Ob es also Regelmäßigkeiten, vielleicht sogar Gesetzmäßigkeiten gäbe, objektiv beobachtbare Relationen, die Prozesse des Vergessens formen und bedingen.
Das wiederum schließt eng an die beiden Positionen der geschichtswissenschaftlichen Thematisierung von Vergessenem an, die ich eingangs am Beispiel Johannes Meyers beschrieben hatte – wäre er zu Recht vergessen, wäre er die Auseinandersetzung gar nicht wert, und wäre er zu Unrecht vergessen, wäre es ein lohnendes Unterfangen, ihn wieder in Erinnerung bringen zu wollen. Diese Positionen können argumentativ nur funktionieren, wenn das Vergessen als ein Prozess begriffen wird, der eben nicht mechanisch oder gar deterministisch verläuft. Denn täte es das, wäre die Frage nach „zu Recht oder zu Unrecht?“ bereits sinnlos, denn durch das Feststellen des Sachverhalts wäre sie bereits beantwortet. Hier scheint also ein zufälliges oder zumindest nicht berechenbares Element des Prozesses angenommen zu werden, und mit der Frage nach „Recht und Unrecht“ eine nach zu verantwortendem menschlichem Handeln (denn in mechanischen Prozessen ist für Verantwortungsfragen kein Platz). Analog funktioniert auch die beliebte Rede vom Vergessensverbot – „X darf nicht vergessen werden“ – die immer schon implizit voraussetzt, dass jenes X, von dem die Rede ist, faktisch sehr wohl vergessen werden könnte, das aber moralisch falsch sei.
Meine Ausgangsfrage „wie funktioniert Vergessen als Prozess in einem bestimmten Ausschnitt historischen Geschehens?“ wirft also die Frage nach Zufälligem und menschlicher Handlungsmacht innerhalb dieses Prozesses direkt auf. Das Ergebnis, auf das ich gekommen bin, kann im Licht der vorangegangenen Diskussion nicht überraschen: Während es einerseits objektivierbare Muster und pfadabhängige Prozessstrukturen des Vergessen-Werdens gibt, sind sie andererseits strukturell unterdeterminiert. Es gibt keine Notwendigkeit, in Vergessenheit zu geraten, sondern viele nicht berechen- oder vorhersagbare Schwellen, die zunächst einmal überschritten werden müssen, um diese Prozesse in Gang zu setzen. Und sie sind prinzipiell revidierbar, solange es die dazu benötigten Grundlagen, also das historische Material, noch gibt.
Vergessensprozesse als historische Prozesse weisen meiner Ansicht nach also sehr direkt darauf hin, dass historische Kausalitäten sehr komplexe Arrangements sind, die oft genug lediglich hinreichenden, aber nicht notwendigen Verknüpfungscharakter tragen, weil Prozesse historischen Vergessens selbst so strukturiert sind. Und eine wesentliche Vorannahme – hier gilt es wieder, sonst implizit bleibende persönliche Aussagebedingungen transparent zu machen – über die Natur historischer Kausalität scheint mir zu sein, dass sie einheitlich gelten müsse. Historische Kausalität mag von naturgesetzlicher Kausalität verschieden sein, aber innerhalb der Geschichte sollten nicht verschiedene Gesetze für verschiedene Gegenstandsbereiche gelten (oder doch?).
Und damit ließe sich anhand konkreter Prozesse historischen Vergessens auch deutlich machen – die Beispiele erspare ich mir an dieser Stelle, sie finden sich (Achtung, Werbung!) im Buch – dass die Frage nach menschlicher Willensfreiheit auf der individuellen und menschlicher Handlungsmacht auf der strukturellen Ebene eine zentrale Frage für Diskussionen zur historischen Kausalität bleibt. Und daher abschließend noch meine Hypothese (die es noch zu testen gilt!): Auch die Rede von der historischen Kausalität ist von der Rede über die Willensfreiheit abhängig. Möglicherweise ist der Zusammenhang so stark, dass beide Positionen jeweils auseinander abgeleitet werden können. Das deutet jedenfalls die Richtung an, in der ich das Thema in Zukunft bearbeiten will. Bevorzugt anhand heute (zu Recht oder Unrecht?) vergessener Positionen der Frühen Neuzeit.