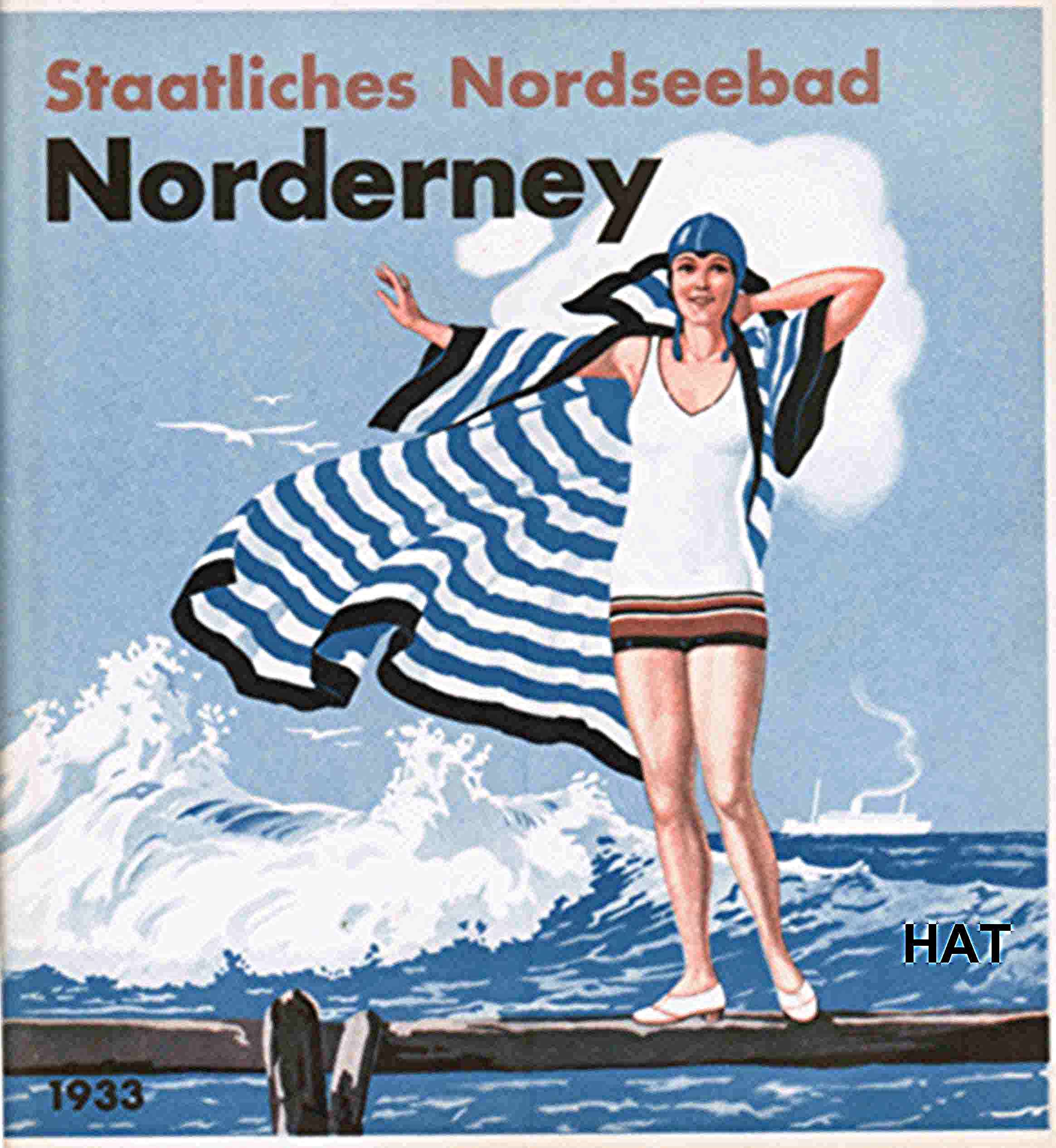
Abstract: Tourism is one of the world’s largest economic sectors — and a product of our thoughts and feelings, of our souls, maltreated by “civilisation.” That says a lot about us. Surprisingly, studying the history of tourism has nevertheless long remained an exotic undertaking. Historical tourism research only gathered momentum in the late 20th century. This contribution critically outlines its development and structures, its strengths and weaknesses.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2023-21497
Languages: German, English
Der “Wanderzug der Urlauber an die See, aufs Land und ins Gebirge”, so der britische Historiker John Pimlott, zählt zu den charakteristischsten Merkmalen der Moderne.[1] Er hat Sitten und Moden geformt, Dörfer zu Großstädten gemacht und völlig neue Wirtschaftszweige erschaffen. Das ist keine ganz neue Diagnose – sie stammt aus dem Jahr 1947. Pimlott dachte an die Zeit vor dem Krieg, als Millionen seiner Landsleute sonntags die Strände von Blackpool und Brighton bevölkerten und die Gutbetuchten vor dem englischen Wetter flohen, in die Schweiz, nach Madeira, an die Riviera. Pimlott war der erste Geschichtsschreiber, der die Bedeutung dieser Freitzeit-“Migration” (das Wort ‚Tourismus’ kannte er noch nicht) erfasst und ihr Werden und Wachsen gewissenhaft untersucht hat.
Vom exotischen Randgebiet zum Boomthema
Damit war er seiner Zeit weit voraus gewesen. Erst drei Jahrzehnte später, als sein Buch neu aufgelegt wurde, wird das Thema vereinzelt wieder aufgegriffen, und zwar nicht von der etablierten Historie, sondern von jungen Außenseitern in England, Deutschland und Frankreich, vor allem aber von Ausstellungsmachern – in den 1980er Jahren erwachte das Publikumsinteresse an der Geschichte des Tourismus.[2]
Dennoch findet sich 1993 in der umfänglichen “Bibliographie zur neueren deutschen Sozialgeschichte” von Hans-Ulrich Wehler, dem Doyen dieser damals diskurshegemonialen Forschungsrichtung, keine Silbe dazu; ebenso noch 1997 in einem 815 Seiten starken Band zur “Europäischen Konsumgeschichte”, obschon er angetreten war, endlich die allseits eingeforderte “Sozialgeschichte in der Erweiterung” umzusetzen. Abgesehen von der Migration und der Transportstatistik zeigte man sich an horizontaler Mobilität generell desinteressiert. Desgleichen am irgendwie unernsten Thema Freizeit und Vergnügen. Und somit erst recht am Reisen, das bloß der “Freizeitgestaltung” dient.
Doch da war der Zug längst abgefahren. Bereits 1991 war der weltweit erste Sammelband mit “Beiträgen zur Tourismusgeschichte” erschienen.[3] Schon zuvor hatte sich an der Freien Universität Berlin eine tourismushistorische Forschungsgruppe konstituiert[4] – ein recht exotisches Projekt, aber bereits 1995 listete eine Bibliographie dazu 729 Aufsätze und Bücher, überwiegend aus Deutschland, auf.[5] Zunächst war die deutschsprachige Forschung führend, inzwischen überwiegen eindeutig englischsprachige Arbeiten.[6]
Seit der Jahrtausendwende lässt sich international sogar von einem kleinen Boom sprechen. Die Geschichte des Tourismus wurde zu einem einigermaßen etablierten Forschungsgebiet, das zwar keine Lehrstühle besetzt, deren Produktionen und Tagungsaktivitäten aber doch so umfangreich sind, dass sich die Exotik des Themas gänzlich verflüchtigt hat. Es gibt lehrbuchartige Übersichten[7] und seit 2009 sogar eine spezielle Fachzeitschrift[8] – nach Thomas Kuhns Wissenschaftstheorie untrügliche Zeichen der Etablierung einer “paradigm small group”.
Freilich, von einem Paradigma im strengen Sinne Kuhns lässt sich, wie so oft in den Kultur- und Geisteswissenschaften, nicht sprechen. Vielmehr haben wir es mit unterschiedlichsten Ansätzen, Themen und Reichweiten zu tun, die ein unscharf begrenztes Feld unter der Überschrift “Tourismus” bilden – und selbst dieses Label wird bisweilen uneinheitlich verwendet (s.u.). Gefragt wird häufig nach der Herausbildung und Diffusion touristischer Praktiken und nach der “Erfindung” von Traditionen, Images und Identitäten, wobei das lange 19. und das 20. Jahrhundert im Mittelpunkt stehen.[9] Gewichtige Arbeiten widmen sich der Rolle des Tourismus in Diktaturen, voran im Dritten Reich, den Ostblockstaaten und in Franco-Spanien, und auch dem Wandel der Wahrnehmung und Gestaltung von “Natur”, der Italiensehnsucht, dem Städtetourismus, dem Tourismus der Arbeiter und der Juden, den Alpenvereinen und den Reiseführern. All dies wird bevorzugt anhand von Organisationen und/oder geographischen Einheiten aufgezeigt.
Kaum ein Land, kaum eine Region, über die nicht gearbeitet würde; ungezählte Orte auf der Welt und etliche Hotels, Veranstalter, Reedereien, Bahnlinien und Airlines haben ihre Tourismuschronisten gefunden. Allerdings wird dabei nicht selten theorielos und detailverliebt vorgegangen; der Übergang zum reich bebilderten Kaffeetisch-Buch ist dann fließend. Betrachtet man die Gesamtheit dieses Forschungsgebiets, so ist eine starke thematische Engführung und somit Fragmentierung zu konstatieren.
Unter den Tisch fällt dann, dass und warum etliche Gebirge und Strände, Wälder und Auen, Dörfer und Städte in etwa zeitgleich und/oder nach gleichen Mustern touristifiziert wurden.[10] Arbeiten sind weiterhin Mangelware, die über den Tellerrand blicken und eine Synthese dieses bunten Feldes leisten, indem sie den Tourismus in längerfristiger und zumindest ansatzweise vergleichender Perspektive untersuchen.
Historische Tourismusforschung
Dies liegt wohl auch daran, dass keine Wissenschaft ein Monopol darauf hält, sich mit dem Tourismus und dessen Geschichte zu befassen; neben der Geschichtswissenschaft tun dies etwa Soziologie, Geographie und Anthropologie.[11] Die Tourismuswissenschaft, das eigentlich zuständige Fach, arbeitet kaum historisch, sieht ihren Gegenstand aber zurecht als “Querschnittsphänomen”. Schon früh wurde daher vorgeschlagen, von einer pluridisziplinären “Historischen Tourismusforschung“ zu sprechen und lediglich deren Produktionen “Tourismusgeschichte” zu nennen,[12] was im deutschen Sprachraum Verbreitung fand, nicht jedoch im englischen.
Nicht zuletzt, weil die fachlichen Grenzen der Historischen Tourismusforschung so offen sind, sollte tunlichst vermieden werden, das Gebiet zu einer uferlosen historischen Reise- oder gar Mobilitätsforschung – und damit tendenziell zu einer Geschichte der Menschheit – aufzublähen. Im Alltag wissen wir ganz gut was die touristische Reise von anderen unterscheidet. Sie dient irgendwie dem “Vergnügen”, sie ist zweckfreier Konsum von Räumen bzw. von darin lokalisierten Symbolen und Erlebnissen – also ein Luxus (der nachträglich oft zweckrational legitimiert wird[13]).
Schon 1795 hatte der Historiker August Ludwig Schlözer das Reisen “in Geschäften” und das Reisen “um zu reisen” unterschieden und damit der Tourismusforschung ein trennscharfes idealtypisches Kriterium für ihren Gegenstand geliefert: den Selbstzweck. Dennoch herrscht hier bisweilen Begriffsverwirrung, wenn es etwa bei Wikipedia unter ‚Tourismus’ heißt: “Die Geschichte des Tourismus ist mit der Geschichte des Reisens größtenteils identisch.” Oder wenn die frühneuzeitliche Ausbildungsreise der jungen Adligen – das Curriculum der monate- teils jahrelangen Grand Tour – dem Tourismus zugeschlagen wird.[14]
Doch der Tourismus ist anders: Erst das vom Bildungszweck “entlastete Reisen wandelte sich zum Tourismus” (Justin Stagl). Kurzum: “Wer noch gezwungen ist, seine Reisen ernst zu nehmen, kann kein Tourist sein.” (Peter Sloterdijk).[15]
Anmerkungen zur Geburt des Tourismus
Es war die beschleunigte Zivilisationsdynamik im Europa des 18. Jahrhunderts, die den touristischen Blick auf Land und Leute und damit die touristische Reise emergent werden ließ.[16] Sie ging Hand in Hand mit einer Neukonzeption der Zeit: An die Stelle der Zyklik trat der Zeitpfeil, sprich: die Entwicklung. Sie erlaubt es, die Dinge – einschließlich der Räume! – nach der in ihnen geronnen Geschichte zu ordnen und in eine genealogische Rangfolge zu bringen. Wer sich durch den Raum bewegt, bewegt sich auch durch die Zeit. “Eine tiefe Historizität dringt in das Herz der Dinge ein.”[17]
Unter den Gebildeten herrschte nun aber keineswegs einmütige Begeisterung über die dynamische Entwicklung, die Europa anderen Kulturräumen vorauseilen ließ. Von der Aufklärung wurde sie als “Fortschritt” gefeiert, zugleich aber von der Romantik als “Entfremdung” vom “Naturzustand” beklagt. Gegen “Künsteley” und “kalte Vernunft” in den städtischen und höfischen Zentren setzte sie das Lob der schlichten Peripherie.
Das Rousseau zugeschriebene “retour à la nature!” markierte eine grundstürzende Neubewertung von Natur und Geschichte: Aus öden Un-Orten und verachteter Rückständigkeit wurden Relikte eines verlorenen Paradieses. Und dieses Paradies wollte man auch betreten. Die touristische Reise war geboren, eine Zeit-Reise “zurück” in eine noch heile, freie, authentische Welt, in ein Chronotopia, wo der “Fortschritt” noch nicht alles durchherrscht. Das Meer und die Berge, bis dato Orte des Schreckens, waren nun “erhabene” Zeugen der göttlichen Schöpfung und erschienen als Refugien von Freiheit, Echtheit und glücklicher, gesunder Genügsamkeit.
So hatte etwa der Schweizer Maler und Dichter Salomon Gessner sein Land als “Idylle” gepriesen: Die Bewohner der bitterarmen, vom Rest der verderbten Welt abgeschotteten Eidgenossenschaft seien noch frei von den “sclavischen Verhältnissen, und von allen den Bedürfnissen, die nur die unglückliche Entfernung von der Natur nothwendig machet.”[18] War es einst die Natur, die den Menschen versklavt, so ist es nun die Kultur.
Leitfossil der Moderne
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wird die kulturkritisch-romantisch motivierte Reise von einer Passion “empfindsamer” Bildungseliten schrittweise zum Massenphänomen der Freizeitreise: Urlaubsregelungen und die im Verkehrswesen eingesetzte Motorkraft erschufen den Fremdenverkehr (wie es lange Zeit hieß[19]) als Wirtschaftsbranche. Allein auf dem Mittelrhein – um 1800 von britischen Pionieren wie Lord Byron als das romantische Zauberland schlechthin gepriesen – beförderten die Dampfer schon um 1850 fast eine Million Passagiere. Freilich, entscheidend für den Siegeszug der touristischen Reise war letztlich nicht das Wie, sondern das Warum dieser seltsamen Form horizontaler Mobilität. Zurecht vermerkte Siegfried Kracauer 1925: “Allzu billig wäre es, diese raumzeitlichen Passionen auf die Entwicklung des Verkehrs zurückzuführen”.[20]
Die touristische Urmotivation, der nostalgisch-kulturkritische, naiv xenophile Blick auf Land und Leute, ist selbst im Getriebe des industrialisierten Massentourismus erstaunlich intakt geblieben. Mehr noch: Längst hat der touristische Blick nahezu alle anderen Reisearten infiziert. Auch wer “geschäftlich” nach New York fliegt, wird abends in Chinatown dinieren, wo es “noch so herrlich authentisch” zugeht. Der Tourismus erweist sich als ein Leitfossil der Moderne.
Die Historische Tourismusforschung, so vielgestaltig sie ist, sollte sich nicht scheuen auch “große” Fragen zu stellen; schließlich thematisiert sie einen zentralen Bereich der Lebenswelt, der global die größte Konsumbranche antreibt. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass aus diesem “Mauerblümchen”[21] heute ein bunter Strauß geworden ist.
_____________________
Literaturhinweise
- Hachtmann, Rüdiger. “Tourismusgeschichte – ein Mauerblümchen mit Zukunft!” H-Soz-Kult (06 October 2011): https://www.hsozkult.de/literaturereview/id/forschungsberichte-1119 (last accessed 05 April 2023).
- Pezda, Jan. “Tourism: Retropian Time-Travel I,” UR Journal of Humanities and Social Sciences 2 (2021): 161–180, https://repozytorium.ur.edu.pl/server/api/core/bitstreams/bc216698-70cc-4f3b-86ac-ed6283b373f8/content (last accessed 05 April 2023).
- Spode, Hasso. “Zur Geschichte der Tourismusgeschichte,” Voyage 8 (2009): 9–22, https://hist-soz.de/publika/JB8_SpodeT.pdf (last accessed 05 April 2023).
Webressourcen
- Eutiner Landesbibliothek: https://lb-eutin.kreis-oh.de/index.php?id=275 (letzter Zugriff 5. April 2023).
- Historisches Archiv zum Tourismus: https://hist-soz.de/hat/ (letzter Zugriff 5. April 2023).
- Interview mit Hasso Spode: LISA, 03 August 2013: https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/der_tourismus_ist_ein_leitfossil_der_moderne?nav_id=4505 (letzter Zugriff 5. April 2023).
_____________________
[1] John A.R. Pimlott, The Englishman’s Holiday (Hassocks: Harvester Press, 1977), 9f.
[2] Zu den Anfängen vgl. Hasso Spode, “Zur Geschichte der Tourismusgeschichte,” Voyage 8 (2009): 9-22; Rüdiger Hachtmann, “Tourismusgeschichte – ein Mauerblümchen mit Zukunft!”, H-Soz-Kult (06 October 2011); und zeitgenössisch die Einleitung zu Zur Sonne, zur Freiheit! ed. Hasso Spode (Berlin: Unikom, 1991), 9-14, https://hist-soz.de/publika/SPODE-Sonne91E.pdf (letzter Zugriff am 05. April 2023).
[3] Spode, Sonne; in Englisch erschienen zwei Überblicksartikel zu dem Gebiet: John Towner, Geoffrey Wall, “History and Tourism,” Annals of Tourism Research 18 (1991): 71-84; sowie schon John Towner, “Approaches to Tourism History,” Annals of Tourism Research 12 (1988): 297-333.
[4] Die 1987 gegründete interdisziplinäre “AG Tourismusgeschichte” existierte bis 2003. Ihre Stelle haben die monodisziplinäre “International Commission of theHistory of Travel” und die pluridisziplinäre “International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility” eingenommen, in gewisser Weise auch die Kommission “Tourismusforschung” der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde.
[5] Barbara Zimmers, Geschichte und Entwicklung des Tourismus (Trier: Geographische Gesellschaft, 1995).
[6] Diese Dominanz hat ihre Tücken: Da Nicht-Englischsprachiges allzu oft ignoriert wird, muss das Rad dann neu erfunden werden; zum anglophonen “Ethnozentrismus” siehe Graham M.S. Dann, Giuli Liebman-Parrinello, ed., The Sociology of Tourism (Bingley: Emerald, 2009), Kap. 1.
[7] Hasso Spode, Wie die Deutschen “Reiseweltmeister” wurden. Eine Einführung in die Tourismusgeschichte (Erfurt: LzT, 2003); Rüdiger Hachtmann, Tourismus-Geschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007); Eric G.E. Zuelow, A History of Modern Tourism (London: Palgrave, 2016).
[8]Journal of Tourism History 1ff (2009ff); Tourismusgeschichtliches schon zuvor im Journal of Transport History, 3rd Ser. 1ff (1980ff) und in Voyage. Jahrbuch für Reise- & Tourismusforschung 1ff (1997ff).
[9] Vgl. Spode, “Zur Geschichte”; Hachtmann, Tourismusgeschichte; Tom Williams, “Going Places: Recent Histories of European Tourism,” Contemporary Europ. History 29 (2014): 295-304; sowie schon John K. Walton, “Taking the History of Tourism Seriously,” Europ. History Quarterly 27 (1997): 563-571.
[10] Vgl. z.B. die Karten bei Andrea Antonescu, Mathis Stock, “Reconstructing the globalisation of tourism,” Annales of Tourism Research 45 (2014): 77-88, sowie von mir – Hasso Spode, “Appell wider das Antiquarische,” https://hist-soz.de/publika/SPODE-Regionalgeschichte14.pdf (letzter Zugriff am 05. April 2023).
[11] Zu den beteiligten Disziplinen vgl. die Diagramme bei Collin M. Hall, Tourism: rethinking the social science of mobility (Harlow: Pearson, 2005), 6. Und Hasso Spode, “Tourismologie?,” in Fernweh und Stadt, ed. Ferdinand Opll, Martin Scheutz (Innsbruck: Studien-Verlag, 2018), 34. https://hist-soz.de/publika/SPODE-Tourismologie182.pdf (letzter Zugriff am 05. April 2023).
[12] Spode, Sonne (Einleitung); Towner, Wall, “History and Tourism”; ausführlicher dann das wegweisende Handbuch von Heinz Hahn, H. Jürgen Kagelmann, ed., Tourismuspsychologie und Tourismussoziologe (München: Quintessenz, 1993), 27-30; Spode, “Tourismologie”.
[13] Vor allem mit der sog. “Erholung”; vgl. Spode, Reiseweltmeister, 70ff.
[14] Besonders im Englischen, etwa bei Towner und Zuelow, was auch daran liegen mag, dass ausgedehnte Reisen bis heute kokett ‚Grand Tour’ genannt werden, obschon diese Institution bereits im späten 18. Jh. obsolet war – erst dann kam übrigens das abwertende Wort ‚tourist’ für sinnlos Umherreisende auf. Zu den Begrifflichkeiten s. Hasso Spode, “Mobilität, Reisen, Tourismus”, in Gesellschaft auf Reisen – Eine Reise in die Gesellschaft, ed. Harald Pechlaner, Michael Volgger (Wiesbaden: Springer, 2017), 23-48, http://hasso-spode.de/lehre/SPODE-Reisen-Mobilitaet-Tourismus17.pdf (letzter Zugriff am 05. April 2023); Les enjeux contemporains du tourisme, ed. Mathis Stock et al. (Rennes: Presses universitaires, 2020), Kap. 1; vgl. auch Voyage 10 (2014) (= Mobilitäten!).
[15] Sloterdijk zit. n. Spode, “Tourismologie”, 27; Stagl zit. n. Spode, Reiseweltmeister, 11.
[16] Dazu Hasso Spode, “‚Reif für die Insel’. Prolegomena zu einer Historischen Anthropologie des Tourismus,” in Arbeit, Freizeit, Reisen, ed. Christiane Cantauw (Münster: Waxmann, 1995), 105-123, https://hist-soz.de/publika/DGV.pdf (letzter Zugriff am 05. April 2023); Hasso Spode, “Der touristische Blick,” in Öffnen, Bewahren, Präsentieren, ed. Staatliche Schlösser und Gärten BW (Mainz: Nünnerich-Asmus, 2017), 138-147, http://hasso-spode.de/publika/SPODE-BW172X.pdf (letzter Zugriff am 05. April 2023); Jan Pezda, “Tourism: Retropian Time-Travel I,” UR Journal of Humanities and Soc. Sciences 2 (2021): 161-180; Julia Gebauer, Entstehung des Tourismus (Saarbrücken: AV, 2012); und zum Geschichtstourismus i.e.S. Valentin Groebner, Retroland (Frankfurt a.M.: S. Fischer, 2018).
[17] Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974), 26.
[18] Zit.n. Spode, “Tourismologie”, 26.
[19] Dieser “amtliche” Begriff aus dem 19. Jh. setzte sich im ersten Drittel des 20. Jh.s in der genuin deutschsprachigen wissenschaftlichen “Fremdenverkehrslehre” durch und wurde daher als Lehnübersetzung in viele Sprachen übernommen (z.B. mouvement des étrangers), bis er in der Nachkriegszeit weitgehend durch ‚Tourismus’ ersetzt wurde. Zu den Anfängen der Tourismusforschung vgl. Dann, Liebman-Parrinello, The Sociology of Tourism, v.a. Kap. 2.
[20] Zit.n. Spode, “Tourismologie”, 26.
[21] Hachtmann, “Tourismusgeschichte”.
_____________________
Abbildungsnachweis
Advertising Flyer Norderney 1933 © HAT (Sig.: D061/01/31/A-Z/-45).
Empfohlene Zitierweise
Spode, Hasso: Was heißt und wie schreibt man Tourismusgeschichte? In: Public History Weekly 11 (2023) 4, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2023-21497.
Redaktionelle Verantwortung
John Pimlott, the British historian, identified the “migration of holidaymakers to the sea, the countryside, the mountains” as one of the most characteristic features of modernity.[1] It has shaped mores and fashions, turned villages into large cities and created entirely new industries. This diagnosis is not really new— it dates from 1947. Pimlott was thinking of the pre-war era, when millions of his compatriots flocked to the beaches of Blackpool and Brighton on Sundays and when the well-heeled fled the English weather to Switzerland, Madeira and the Riviera. Pimlott was the first historian to grasp the significance of this leisure “migration” (he did not yet know the word “tourism”) and to scrupulously examine its emergence and growth.
From an Exotic Sideline to a Booming Concern
His inquiry placed Pimlott far ahead of his time. It was only three decades later, when his book was reprinted, that the subject was taken up again, here and there, not by established historians, but by young outsiders in England, Germany and France, and above all by exhibition makers —public interest in the history of tourism arose in the 1980s.[2]
Still, it goes unmentioned in the extensive “Bibliography of Modern German Social History” (Bibliographie zur neueren deutschen Sozialgeschichte), published in 1993 by Hans-Ulrich Wehler, the doyen of this hegemonic discourse and line of research at the time; likewise in a volume on “European Consumer History” (Europäische Konsumgeschichte) from 1997, which claimed to at long last heed the many calls to extend the scope of social history. Apart from migration and transport statistics, there was a general lack of interest in horizontal mobility. The same was true of the somehow unserious topic of leisure and pleasure, and thus even more so in travel, which merely serves “leisure and recreation.”
But by then the train had already left. The first-ever anthology of “Contributions to Tourism History” had already been published in 1991.[3] Four years earlier a tourism history research group had been established at Freie Universität Berlin[4] — although the subject remained rather exotic, as early as 1995 a bibliography listed 729 essays and books, mostly from Germany.[5] Initially, German-speaking research led the way, but meanwhile English-speaking publications have gained the upper hand.[6]
Since the turn of the millennium, an international boom of sorts is evident. Tourism history has in some ways become an established field of research. Despite having no university chairs, its output and conference activities are so extensive that the subject has long ceased being exotic. Textbook-like reviews[7] have emerged and, since 2009, even a dedicated journal[8]— according to Thomas Kuhn’s theory of science, these are unmistakable signs of the establishment of a “paradigm small group.”
Admittedly, as so often happens in the humanities, we cannot speak of a paradigm in Kuhn’s strict sense. Rather, the highly diverse approaches, topics and scopes form a blurred field under the heading of “tourism”— and even this label is sometimes used inconsistently (see below). Tourism research often explores the formation and diffusion of tourism practices and the “invention” of traditions, images and identities, with a focus on the long 19th century and the 20th century.[9] Major studies consider the role of tourism in dictatorships, above all in the Third Reich, Eastern Bloc countries and Franco’s Spain. Other topics include the changing perception and shaping of “nature,” the “italomania” of northern countries, city tourism, the workers and the Jews as tourists, Alpine clubs and travel guides. These topics tend to be studied in terms of organisations and/or geographical units.
Barely any country or region has not been written about; just as countless places across the world and many hotels, tour operators, shipping companies, railway lines and airlines have been chronicled by tourism researchers. Such studies, however, often lack a theoretical basis and obsess over details, making the transition to coffee-table books quite fluid. Thematically, this field of research is often very narrow and thus fragmented.
Accordingly, it ignores the fact that and the reasons why plenty of mountains and beaches, forests and meadows, villages and towns were touristified at roughly the same time or according to the same patterns.[10] Studies which think outside the box and synthesise this variegated field by examining tourism in a longer-term and at least rudimentary comparative perspective are few and far between.
Historical Tourism Research
This state of research probably also results from no field of inquiry having a monopoly on exploring tourism and its history; besides history, tourism is also studied in sociology, geography and anthropology.[11] Tourism studies, the discipline that is actually responsible, while barely historical, rightly considers its subject a “cross-sectional phenomenon”. It was therefore suggested early on to speak of pluridisciplinary “historical tourism research” and to only call its output “tourism history”;[12] this designation became widespread among German-speaking researchers, but not among English-speaking ones.
Not least because the disciplinary boundaries of historical tourism research are so open should any attempt to inflate the field to limitless historical travel research — and thus potentially to a history of humanity —be avoided as far as possible. In everyday terms, we know quite well what distinguishes tourist journeys from others. They somehow serve “pleasure,” involve the purpose-free consumption of spaces or of the symbols and experiences localised within them — and thus are a luxury (often legitimised after the fact in terms of rational purposes[13]).
As early as 1795, the German historian August Ludwig Schlözer distinguished travelling “for business” and travelling “in order to travel,” thus providing tourism research with a sharply delimited ideal-type criterion for its subject of investigation: the end in itself. Still, the terms are sometimes confused. For example, the German Wikipedia entry on “tourism” states that “The history of tourism is largely identical with the history of travel.” Or the young nobleman’s early modern educational journey — the curriculum of the Grand Tour, which lasted months and sometimes years — is attributed to tourism.[14]
Tourism, however, is different: Only “travel relieved [from its educational purpose] transformed into tourism” (Justin Stagl). In sum: “Those still compelled to take their travels seriously cannot be tourists” (Peter Sloterdijk).[15]
Notes on the Birth of Tourism
The accelerated dynamics of civilisation in 18th-century Europe produced the tourist gaze on a country and its people, and thus the tourist journey.[16] This perspective coincided with a new conception of time: development ousted cyclicity. It enables arranging things — including spaces! —in terms of the history that has solidified therein and placing them in a genealogical order. Whoever moves through space also moves through time. “A profound historicity penetrates into the heart of things.”[17]
The educated classes, however, by no means simply enthused over the dynamic development that put Europe ahead of other cultural spheres. The Enlightenment celebrated this advancement as “progress” whereas Romanticism deplored it as “alienation” from the “natural state.” The Romantics praised the simple, unadulterated periphery over the “artifice” and “cold-hearted reason” of the urban and courtly centres.
“Retour à la nature!” — the dictum falsely attributed to Rousseau — marked a fundamental reassessment of nature and history: desolate non-places and despised backwardness became the relics of a lost paradise. And people wanted to enter this paradise. The tourist journey was born, a journey “back in time” to a still perfect, free and authentic world, to a chronotopia where “progress” did not yet dominate everything. The sea and the mountains, hitherto awe-inspiring, terrifying places, now became “sublime” witnesses of divine creation, refuges of freedom, authenticity and a blissful, healthy frugality.
The Swiss painter and poet Salomon Gessner, for example, hailed his country as an “idyll”: the inhabitants of the bitterly poor Confederation, cut off from the rest of the depraved world, were still free from the “slavish conditions, and from all the needs that only the unfortunate distance from nature makes necessary.”[18] If nature had once enslaved humankind, now it was culture.
An Index Fossil of Modernity
Since the mid-19th century, the Romantic journey, motivated by cultural criticism, gradually evolved from a passion of “sentient” educated elites into the mass phenomenon of leisure travel: holiday regulations and motorised transport turned “tourist movement” (as tourism was called until the 1950s[19]) into an economic sector. On the Middle Rhine alone —heralded around 1800 by British pioneers such as Lord Byron as the Romantic wonderland —, steamships carried almost a million passengers by 1850. Admittedly, the decisive factor in the triumph of the tourist journey was ultimately not the how, but the why of this strange form of horizontal mobility. Siegfried Kracauer rightly noted in 1925: “It would be too simple to attribute these spatiotemporal passions to the development of transport alone.”[20]
The original touristic motivation – the nostalgic, culturally critical, naively xenophile view of a country and its people – has remained amazingly intact even in the machinery of industrialised mass tourism. Well, actually, more than that: the tourist gaze has long since infected almost all other types of travel. Even those who fly to New York “for business” will dine in Chinatown in the evening, where everything is “still so marvellously authentic.” Tourism is proving to be an index fossil of modernity.
Historical tourism research, however multifaceted, should not shun the “big” questions; after all, it deals with a core aspect of the lifeworld driving the largest consumer industry worldwide. It is therefore very welcome that this “wallflower”[21] has today become a colourful bouquet.
_____________________
Further Reading
- Hachtmann, Rüdiger. “Tourismusgeschichte – ein Mauerblümchen mit Zukunft!” H-Soz-Kult (06 October 2011): https://www.hsozkult.de/literaturereview/id/forschungsberichte-1119 (last accessed 05 April 2023).
- Pezda, Jan. “Tourism: Retropian Time-Travel I,” UR Journal of Humanities and Social Sciences 2 (2021): 161–180, https://repozytorium.ur.edu.pl/server/api/core/bitstreams/bc216698-70cc-4f3b-86ac-ed6283b373f8/content (last accessed 05 April 2023).
- Spode, Hasso. “Zur Geschichte der Tourismusgeschichte,” Voyage 8 (2009): 9–22, https://hist-soz.de/publika/JB8_SpodeT.pdf (last accessed 05 April 2023).
Web Resources
- Eutiner Landesbibliothek: https://lb-eutin.kreis-oh.de/index.php?id=275 (letzter Zugriff 5. April 2023).
- Historisches Archiv zum Tourismus: https://hist-soz.de/hat/ (letzter Zugriff 5. April 2023).
- Interview mit Hasso Spode: LISA, 03 August 2013: https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/der_tourismus_ist_ein_leitfossil_der_moderne?nav_id=4505 (letzter Zugriff 5. April 2023).
_____________________
[1] John A.R. Pimlott, The Englishman’s Holiday (Hassocks: Harvester Press, 1977), 9f.
[2]On the beginnings of historical tourism research, see Hasso Spode, “Zur Geschichte der Tourismusgeschichte,” Voyage 8 (2009): 9–22; Rüdiger Hachtmann, “Tourismusgeschichte – ein Mauerblümchen mit Zukunft!,” H-Soz-Kult (06 October 2011); and cf. The introduction to Zur Sonne, zur Freiheit! ed. Hasso Spode (Berlin: Unikom, 1991), 9–14, https://hist-soz.de/publika/SPODE-Sonne91E.pdf (last accessed 05 April 2023).
[3] Spode, Sonne; in English two review articles have appeared: John Towner, Geoffrey Wall, “History and Tourism,” Annals of Tourism Research 18 (1991), 71–84; John Towner, “Approaches to Tourism History”, Annals of Tourism Research 12 (1988): 297–333.
[4]Founded in 1987, the interdisciplinary “AG Tourismusgeschichte” existed until 2003. Its successors are the monodisciplinary “International Commission of the History of Travel” and the pluridisciplinary “International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility,” and to some extent also the Committee for “Tourism Research” of the German Society of Folklore and Folklore Studies.
[5] Barbara Zimmers, Geschichte und Entwicklung des Tourismus (Trier: Geographische Gesellschaft, 1995).
[6]This prevalence has its pitfalls: since non-English studies all too often are ignored, the wheel not infrequently needs to be reinvented; on this Anglophone “ethnocentrism” see Graham M.S. Dann, Giuli Liebman-Parrinello, ed., The Sociology of Tourism (Bingley: Emerald, 2009), Chapter 1.
[7] Hasso Spode, Wie die Deutschen “Reiseweltmeister” wurden. Eine Einführung in die Tourismusgeschichte (Erfurt: LzT, 2003); Rüdiger Hachtmann, Tourismus-Geschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007); Eric G.E. Zuelow, A History of Modern Tourism (London: Palgrave, 2016).
[8]Journal of Tourism History 1ff (2009ff); for earlier contributions to tourism history, see the Journal of Transport History, 3rd Ser. 1ff (1980ff) and Voyage. Jahrbuch für Reise- & Tourismusforschung 1ff (1997ff).
[9]See Spode, “Zur Geschichte”; Hachtmann, Tourismusgeschichte; Tom Williams, “Going Places: Recent Histories of European Tourism,” Contemporary Europ. History 29 (2014): 295–304; one earlier study is John K. Walton, “Taking the History of Tourism Seriously,” Europ. History Quarterly 27 (1997): 563–571.
[10]See, for example, the maps in Andrea Antonescu and Mathis Stock, “Reconstructing the globalisation of tourism,” Annales of Tourism Research 45 (2014): 77–88.
[11]On the involved disciplines, see the diagrams in Collin M. Hall, Tourism: rethinking the social science of mobility (Harlow: Pearson, 2005), 6. And Hasso Spode, “Tourismologie?,” in Fernweh und Stadt, ed. Ferdinand Opll, Martin Scheutz (Innsbruck: Studien-Verlag, 2018), 34. https://hist-soz.de/publika/SPODE-Tourismologie182.pdf (last accessed on 05. April 2023).
[12] Spode, Sonne (Introduction); Towner, Wall, “History and Tourism”; for a more extensive account, see the landmark handbook of Heinz Hahn, H. Jürgen Kagelmann, ed., Tourismuspsychologie und Tourismussoziologe (Munich: Quintessenz, 1993), 27–30, Spode, “Tourismologie.”
[13]First and foremost, so-called “recuperation”; see Spode, Reiseweltmeister, 70ff.
[14]Especially in English, which may also be due to the fact that extended journeys are still coquettishly called “Grand Tours” today, although this institution was already obsolete in the late 18th century — only at the time, incidentally, was the pejorative word “tourist” used to identity those who travelled around pointlessly. For a discussion of the terms and concepts, see Hasso Spode, “Mobilität, Reisen, Tourismus,” in Gesellschaft auf Reisen – Eine Reise in die Gesellschaft, ed. Harald Pechlaner, Michael Volgger (Wiesbaden: Springer, 2017), 23–48, http://hasso-spode.de/lehre/SPODE-Reisen-Mobilitaet-Tourismus17.pdf (last accessed 05 April 2023).
[15] Sloterdijk quoted after Spode, „Tourismologie“, 27; Stagl quoted after Spode, Reiseweltmeister, 11.
[16] See Hasso Spode, “‘Reif für die Insel’. Prolegomena zu einer Historischen Anthropologie des Tourismus,” in Arbeit, Freizeit, Reisen, ed. Christiane Cantauw (Münster: Waxmann, 1995), 105–123, https://hist-soz.de/publika/DGV.pdf (last accessed 05 April 2023); Hasso Spode, “Der touristische Blick,” in Öffnen, Bewahren, Präsentieren, ed. Staatliche Schlösser und Gärten BW (Mainz: Nünnerich-Asmus, 2017), 138–147; Jan Pezda, “Tourism: Retropian Time-Travel I,” UR Journal of Humanities and Soc. Sciences 2 (2021): 161–180; Julia Gebauer, Entstehung des Tourismus (Saarbrücken: AV, 2012); see also Valentin Groebner. Retroland (Frankfurt a.M.: S. Fischer, 2018).
[17] Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (New York: Vintage Books, 1994), xxiii.
[18]Cited in Spode, “Tourismologie,” 26.
[19] In the first third of the 20th century the genuinely German-language tourism science spoke of Fremdenverkehr (literally: traffic of strangers); this term war adopted as a loan translation in many languages (e.g. mouvement des étrangers) until it was replaced by ‘tourism’ in the post-war period. For the beginnings of tourism research, see Dann, Liebman-Parrinello, The Sociology of Tourism.
[20]Cited in Spode, “Tourismologie,” 26.
[21]Hachtmann, “Tourismusgeschichte”.
_____________________
Image Credits
Advertising Flyer Norderney 1933 © HAT (Sig.: D061/01/31/A-Z/-45).
Recommended Citation
Spode, Hasso. “What is Tourism and How to Write its History?” In: Public History Weekly 11 (2023) 4, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2023-21497.
Editorial Responsibility
Copyright © 2023 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact the editor-in-chief (see here). All articles are reliably referenced via a DOI, which includes all comments that are considered an integral part of the publication.
The assessments in this article reflect only the perspective of the author. PHW considers itself as a pluralistic debate journal, contributions to discussions are very welcome. Please note our commentary guidelines (https://public-history-weekly.degruyter.com/contribute/).
Categories: 11 (2023) 4
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2023-21497
Tags: History of Tourism, Language: German, Tourism (Tourismus)
English version below. To all readers we recommend the automatic DeepL-Translator for 22 languages. Just copy and paste.
OPEN PEER REVIEW
Eine sehr spezielle Dienstleistungsindustrie
Der Aufstieg des Tourismus, den Hasso Spode in seinem historische Panorama so elegant entwirft, zeigt vor allem eines: die Romantik hat über die Aufklärung gesiegt. Denn die Suche nach dem Echten von Früher – die vermeintliche unberührte alpine Idylle oder die pittoreske mittelalterliche Stadt am See – und die technische Beschleunigung widersprechen sich überhaupt nicht, sondern verstärken einander gegenseitig. Deswegen hat sie in den letzten zwei Jahrhunderten Simulakra und Simulationen in vorher unbekanntem Ausmass erzeugt. Durch diese Vermarktung ist das schöne Anderswo entstanden, das Touristen besuchen: Tourismus ist seither jene Industrie, die sich erfolgreich als das Gegenteil von Industrie verkauft.
Das macht auch ihre Geschichte einzigartig. Sie lässt sich eben nicht als Verkehrs-, sondern vor allem als Konsumgeschichte angemessen analytisch beschreiben, wie Hasso Spode zu Recht betont. Denn Tourismus hat ein paar grundsätzliche Eigenschaften, die ihn von anderen Dienstleistungssektoren unterscheiden.
Seit dem 19. Jahrhundert ist Fremdenverkehr ein Allesfresser, der sich selbst zur Attraktion macht. Seither finden Reisende nichts so attraktiv wie die Tatsache, dass ein Ort viele andere Reisende anzieht. Tourismus ist gleichzeitig von Beginn an die Industrie des schlechten Gewissens: Die Verwüstung der Alpen durch ihre vielen begeisterten Besucher hat bereits John Ruskin in den 1850er und 1860er Jahren bitter beklagt, und seitdem hat das nicht mehr aufgehört. Wenn ein Ort erst einmal zur touristischen Marke geworden ist, ist die offensichtlich unzerstörbar, egal wie monströs, übernutzt und banal das ursprünglich besondere Schöne geworden ist.
Tourismus ist ein Superreplikator: Gegen die Probleme, die Fremdenverkehr erzeugt, hilft nur noch mehr vom selben. Denn Urlaub, der nicht mehr im Dienst sozialer Hierarchien und kommerziellen Profits stehe, sondern kollektiver Fortschritt und individuelle Wunscherfüllung gleichzeitig sei, ist seit mehr als einem Jahrhundert ebenfalls Teil des Tourismus. Solche alternative und selbstverwaltete Ferien wollten die engagierten Wandervögel der Jugendbewegung um 1900; die sozialistischen Bildungsreisen und Jugendherbergen der französischen Volksfront 1936 und ihre späteren kirchlichen Ableger oder Fortsetzer; die Beatniks der 1950er, die Hippies der 1960er, die ökologischen Initiativen der 1980er und die Dritte Welt-Aktivistinnen der 1990er. Und damit hatten sie Erfolg. Sie erschlossen pittoreske Küsten, Täler, Wälder, Inseln und neue Orte, wo vorher niemand hingewollt hatte, für neue Besucher. Der kommerzielle Normaltourismus wurde aber davon nicht weniger, im Gegenteil, er bekam neue Destinationen, neue Attraktionen und neue Infrastruktur. Alternativtourismus oder “Anders Reisen”, seit gut 50 Jahren als Forderung und Versprechen in einem formuliert, bedeutete in der Praxis einfach: noch mehr Reisen.
Tourismus inszeniert sich seit fast 200 Jahren als Anti-Arbeit und wiedergewonnene Lebenszeit: Aber er beruht auf den ökonomischen Unterschieden zwischen denen, die reisen, und denen, die bereist werden. Die Reisenden haben sehr viel grössere Ressourcen an Geld (und damit an freier Zeit) als diejenigen, die bereist werden. Auf dem Abschöpfen dieser Unterschiede beruht der Tourismus: Konsumenten mit viel Geld und Zeit auf der einen Seite; Arbeitskräfte mit niedrigen Löhnen auf der anderen, mit denen man arbeitsintensive Dienstleistungen sehr billig anbieten kann. Service- und Putzkräfte, Kellner und Zimmermädchen waren seit dem 19. Jahrhundert zum allergrössten Teil niedrig bezahlte Saisonkräfte, die in miserablen Unterkünften und teilweise nur von Trinkgeldern lebten. In der Schweiz hiess die Tuberkulose am Ende des 19. Jahrhunderts “Hotelkrankheit”: Gemeint waren nicht die Gäste, sondern die dort Angestellten.
Tourismus ist deswegen eine Differenzierungsmaschine, die soziale Gruppenzugehörigkeiten markiert und verstärkt. Urlaub ist Konsum und gleichzeitig soziale Pflicht, von der die Beteiligten fest behaupten, sie sei gar keine, sondern spontaner Ausnahmezustand und Belohnung. Die Formel vom “Urlaub für alle” war zuerst im Italien der 1920er Jahre von der faschistischen “Opera Nazionale Dopolavoro” mit staatlich geförderten Ferienheimen und Ferienprogrammen geprägt worden. Sie wurde in den 1930ern sowohl von den Nationalsozialisten wie von der linken Volksfrontregierung in Frankreich kopiert und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zur Zauberformel für neue Varianten von Massenkonsum – Skifahren ist ein besonders interessantes Beispiel.
Von der touristischen Erschliessung und Entwicklung eines Ortes profitieren aber nicht alle, die dort wohnen. Sondern – das zeigen historische Studien für das 19. Jahrhundert ebenso wie aktuelle sozialwissenschaftliche und ökonomische Analysen aus dem 20. und 21. Jahrhundert – vor allem diejenigen, die dort Immobilien besitzen, Grundstücke und Häuser. Tourismus ist die Produktion von künstlichen Welten, die sehr reale Renditen versprechen.
Denn Reiseanbieter verkaufen etwas, was ihnen nicht gehört, nämlich Landschaften, Berge, Stadtbilder und den damit verbundenen attraktiven öffentlichen Raum. Sie ziehen Gewinn daraus, den Zugang zu etwas zu vermarkten, für das sie selbst nichts bezahlt haben. 2019 waren fast 1,5 Milliarden Touristen unterwegs – so viele wie noch nie zuvor, im Schnitt jeder zwölfte Einwohner des Planeten. Die anderen elf Zwölftel konnten sich das nicht leisten, die hatten zu tun.
Tourismus, hat der singhalesische Publizist Indi Samarajiva im Frühjahr 2020 etwas schnippisch formuliert, sei effizient organisierte organisierte Ungleichheit: “Kolonialismus mit Trinkgeldern”. Und davon handelt die Tourismusgeschichte eben auch.
__________
A Very Particular Service Industry
The rise of tourism, which Hasso Spode outlines so elegantly in his historical panorama, highlights one thing above all: Romanticism has triumphed over the Enlightenment. The quest for the genuine, unadulterated things of old — the supposedly untouched Alpine idyll or the picturesque medieval town by a lake — and technical acceleration are not contradictory, but reinforce each other. This explains why this search has produced simulacra and simulations on an unprecedented scale in the last two centuries. The marketing this involves has created the beautiful elsewhere that tourists visit: tourism has since become an industry that successfully sells itself as the opposite of industry.
This also makes its history unique. It cannot be adequately described analytically as a history of transport, but above all as a history of consumption, as Hasso Spode rightly points out. For tourism has some fundamental characteristics that distinguish it from other service sectors.
Since the 19th century, tourism has been omnivorous, and has turned itself into an attraction. Travellers have since found nothing quite as attractive as the fact that a place attracts many other travellers. From the outset, tourism has also been the industry of guilty conscience: John Ruskin bitterly lamented the devastation of the Alps by their many enthusiastic visitors already in the 1850s and 1860s, and it hasn’t stopped since. Once a place has become a tourism brand, it becomes indestructible, no matter how monstrous, overused and banal what was once so beautiful has become.
Tourism is a super-replicator: only more of the same can help counter the problems created by tourism. Because holidays, which no longer serve social hierarchies and commercial profit, but simultaneously constitute collective progress and individual wish fulfilment, have also been part and parcel of tourism for over a century. Such alternative and self-managed holidays were the goal of the socially committed ramblers of the youth movement around 1900; the socialist educational trips and youth hostels of the French Popular Front in 1936 and their later ecclesiastical offshoots or successors; the beatniks of the 1950s, the hippies of the 1960s, the ecological initiatives of the 1980s and the Third World activists of the 1990s. They succeeded. They made hitherto untraveled picturesque coasts, valleys, forests, islands and new places accessible to new visitors. This, however, did not curb normal, commercial tourism; on the contrary, new destinations, new attractions and new infrastructure were created. In practice, alternative tourism or “travelling differently,” both demanded and promised for over 50 years, simply meant: even more travelling.
Tourism has been staging itself as the antithesis of work and as time regained for almost 200 years: and yet, it rests on the economic differences between those who travel and those who are travelled. Travellers have far greater financial resources (and thus free time) than the travelled. Tourism is based on leveraging these differences: well-heeled consumers with plenty of time on the one hand; low-paid workers on the other. This constellation enables providing labour-intensive services very cheaply. Since the 19th century, service and cleaning staff, waiters and chambermaids have largely been low-paid seasonal workers who lived in miserable accommodation and sometimes only on tips. In late-19th century Switzerland, tuberculosis was called the “hotel disease”: this did not refer to the guests, but to staff.
Tourism is therefore a differentiation machine that marks and reinforces social group affiliations. Holidays are consumption and at the same time a social obligation, which those involved firmly claim is not a duty at all, but a spontaneous exception and reward. First coined in Italy in the 1920s by the fascist “Opera Nazionale Dopolavoro,” the formula of “holidays for all” involved state-sponsored holiday homes and recreation programmes. It was copied in the 1930s by both the National Socialists and the left-wing Popular Front government in France. After the Second World War, it became the magic formula for new varieties of mass consumption — skiing is a particularly interesting example.
However, not everyone who lives in a place developed by tourism benefits. Rather, historical studies of the 19th century as well as current sociological and economic analyses of the 20th and 21st centuries show that primarily real estate and land owners benefit. Tourism is the production of artificial worlds that promise very real returns.
For tour operators sell what does not belong to them: landscapes, mountains, cityscapes and the attractive public space associated with such places. They profit from marketing access to what they have paid nothing for. In 2019, almost 1.5 billion tourists were on the move — more than ever, and on average every twelfth inhabitant of the planet. Having other more pressing things to do, the other eleven-twelfths could not afford the pleasure.
Tourism, as the Sinhalese writer Indi Samarajiva somewhat flippantly put it in the spring of 2020, is efficiently organised inequality: “colonialism with tips.” And that is what the history of tourism is also about.
To all readers we recommend the automatic DeepL-Translator for 22 languages. Just copy and paste.
Erinnerungskultur & historische Bildung dank Tourismus
Gerade eben wurde eine neuer Weltrekord aufgestellt. Der Brite, Jamie McDonald, hat in nur 6 Tagen, 16 Stunden und 14 Minuten die sieben Weltwunder der Neuzeit besucht.[1] Mit diesem Weltrekord schafft er es ins Guinessbuch der Rekorde. Diese Leistung in weniger als einer Woche ist Ausdruck unserer schnelllebigen Zeit und steht für den heutigen Tourismus. Wie Valentin Groebner festhält: «Wer einen Reiseführer liest, bekommt stets Anleitungen, wie man möglichst schnell zu den besten Orten kommt. Und der Tourist möchte in der Regel möglichst schnell an den richtigen Punkt».[2] Es geht also nicht so sehr darum, dass man einen Ort in Ruhe besucht und sich mit dessen Geschichte auseinandersetzt, sondern lediglich darum, möglichst viele Orte in möglichst kurzer Zeit zu besuchen. Fundamentales Element dabei ist das Foto, welches in den sozialen Medien geteilt wird. Ein Bild belegt für alle Zeiten «been there, seen that, done that», wie der englische Ausdruck treffend beschreibt.
Historische Originalschauplätze werden heute oft nicht mehr aus ernsthaftem Interesse besucht. Es scheint, dass keine historische Auseinandersetzung damit stattfindet. Die historischen Sehenswürdigkeiten dienen lediglich dem Tourismus, welcher sie für kommerzielle Zwecke gezielt nutzt. Im Extremfall werden historische Orte zu einem Aufhänger reduziert, der zahlende Kunden bringt.
Das stimmt public historians nachdenklich. Ist es doch deren Ziel Geschichtsvermittlung zu betreiben. Tourismus und Geschichte können sich nämlich im Idealfall wunderbar gegenseitig bereichern. Auch wenn die geschehene Geschichte unwiederbringlich vorbei ist, so kann doch mit Quellen aus der referierten Geschichte ein wissenschaftlich fundiertes Narrativ geschrieben werden. Damit wird Geschichte spannend dargestellt, in einer Art und Weise welche Touristen fasziniert und ihnen historische Bildung mittels eines Erlebnisses ermöglicht.
Es stellt sich die Frage, warum denn Touristen um die Welt reisen und Fotos von sich an historischen Orten machen, wenn sie gar nicht so sehr an deren Geschichte interessiert sind. Vielmehr suchen sie nach Bestätigungen, schliesslich wird ja auch jeder Schritt und jedes Bild gleich auf den sozialen Medien geteilt. Dieser Prozess hat identitätsstiftenden Charakter. Christine Gundermann schreibt mit Bezug auf Maurice Halbwachs: «Gruppen teilen und formen zugleich ein kollektives Gedächtnis, d.h., individuelle Erinnerung und kollektives Gedächtnis durchdringen sich wechselseitig. Sie sind gruppenspezifisch und tragen zur Konstruktion und Reproduktion von kollektiver Identität bei.»[3]
Damit bewegen wir uns in der Erinnerungskultur. Innerhalb einer Gesellschaft wird Erinnerung via die Kommunikation geschaffen. Daher müssen die Bilder geteilt werden. Sie müssen auch kommentiert werden. Es ist eine soziale Handlung. Erinnerung wird sogar ausgehandelt. Entsprechend macht es auch Sinn, dass alle das gleiche Bild machen wollen. Welche Bilder kopiert werden, bestimmt woran man sich in der Gruppe erinnert. Und welche Bilder nicht kopiert werden, ist ebenso aussagekräftig. Dieses kollektive Erinnern gibt der Gruppe eine Identität. So hat dieser Trend heute für viele Menschen eine ganz wichtige Funktion. Denn gerade in einer Welt wo das Individuum in der Anonymität unterzugehen droht, ist Identitätsstiftung umso wichtiger. Spannend an dieser Diskussion ist, dass im Tourismus prosthetic memory nach Alison Landsberg dank Erlebnissen und Emotionen besonders gut greift.[4] Unabhängig von der Herkunft, Religion oder Kultur, kann sich jede/r Reisende Erinnerungen aus der ganzen Welt, von allen Kulturen und über alle Zeiten aneignen.
In diesem Sinn trägt der Tourismus vielleicht höchstens zur Erinnerungskultur bei. Und doch finden sich auf den sozialen Medien immer wieder Beiträge, die darüber hinaus gehen. Nicht nur werden Bilder geteilt, sondern in einen sinngebenden Zusammenhang gebracht, gespickt mit Jahreszahlen, unterlegt mit fundierten wissenschaftlichen Fakten und mit Bezug zu historischen Quellen. Es entstehen Narrative. Hier findet historische Bildung dank Tourismus statt, sowohl beim Autor/in wie bei den Nutzenden.
[1] «Sieben Weltwunder in sieben Tagen». In: https://www.travelnews.ch/trips-and-travellers/23951-sieben-weltwunder-in-sieben-tagen.html, Abgerufen am 25. Mai 2023.
[2] NZZ Interview mit Valentin Groebner. In: https://www.nzz.ch/schweiz/interview-mit-valentin-groebner-ueber-die-illusion-der-freiheit-in-den-ferien-ld.1736614, Abgerufen am 7. Mai 2023.
[3] Christine Gundermann, «Erinnerung und Gedächtnis», In: Christine Gundermann u.a. Schlüsselbegriffe der Public History. Göttingen, Stuttgart 2021. S. 73.
[4] Alison Landsberg, Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of ass Culture, New York 2004.